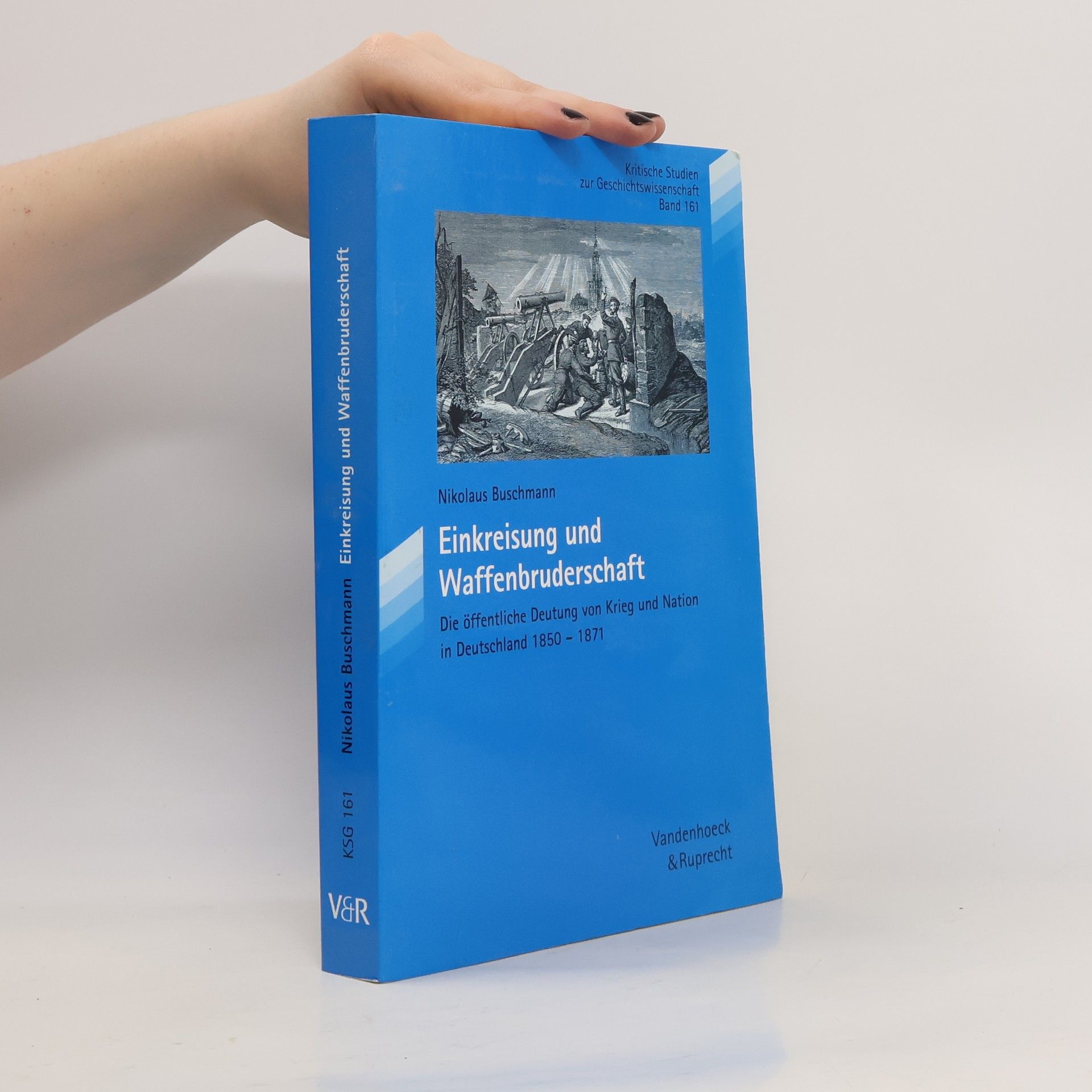Die Auseinandersetzung der deutschen Öffentlichkeit mit Krieg und Nation in den beiden Jahrzehnten vor der Reichsgründung stand unter dem Eindruck widerstreitender nationalpolitischer Zukunftsoptionen. Nikolaus Buschmann analysiert die Wahrnehmung einer von Kriegen und Krisen geschüttelten Phase der deutschen Geschichte auf der Basis von Tageszeitungen, politischen Zeitschriften und Unterhaltungsmagazinen. Im Mittelpunkt seiner Untersuchung stehen die zeitgenössischen Vorstellungen vom modernen Krieg, Strategien seiner Legitimation, religiöse Aspekte der Kriegswahrnehmung sowie Feindbilder und Bedrohungsphantasien. Dabei wird deutlich, dass der Krieg eine für unterschiedliche weltanschauliche Orientierungen offene Projektionsfläche nationaler Selbstdeutung bot. Dies trug wesentlich dazu bei, die Nation als Bezugsrahmen politischer und kultureller Orientierung in der zeitgenössischen Vorstellungswelt zu verankern – allerdings um den Preis, dass das kriegerische Leitbild der »wehrhaften Geschlossenheit« zum Fluchtpunkt der nationalen Selbstidentifikation wurde.
Nikolaus Buschmann Livres