Loccumer Protokolle - 79/16: Unvermeidliche Königsdisziplinen?
Zur forschungspolitischen Relevanz des Selbstverständnisses von Geistes- und Sozialwissenschaften im norddeutschen Raum
- 188pages
- 7 heures de lecture
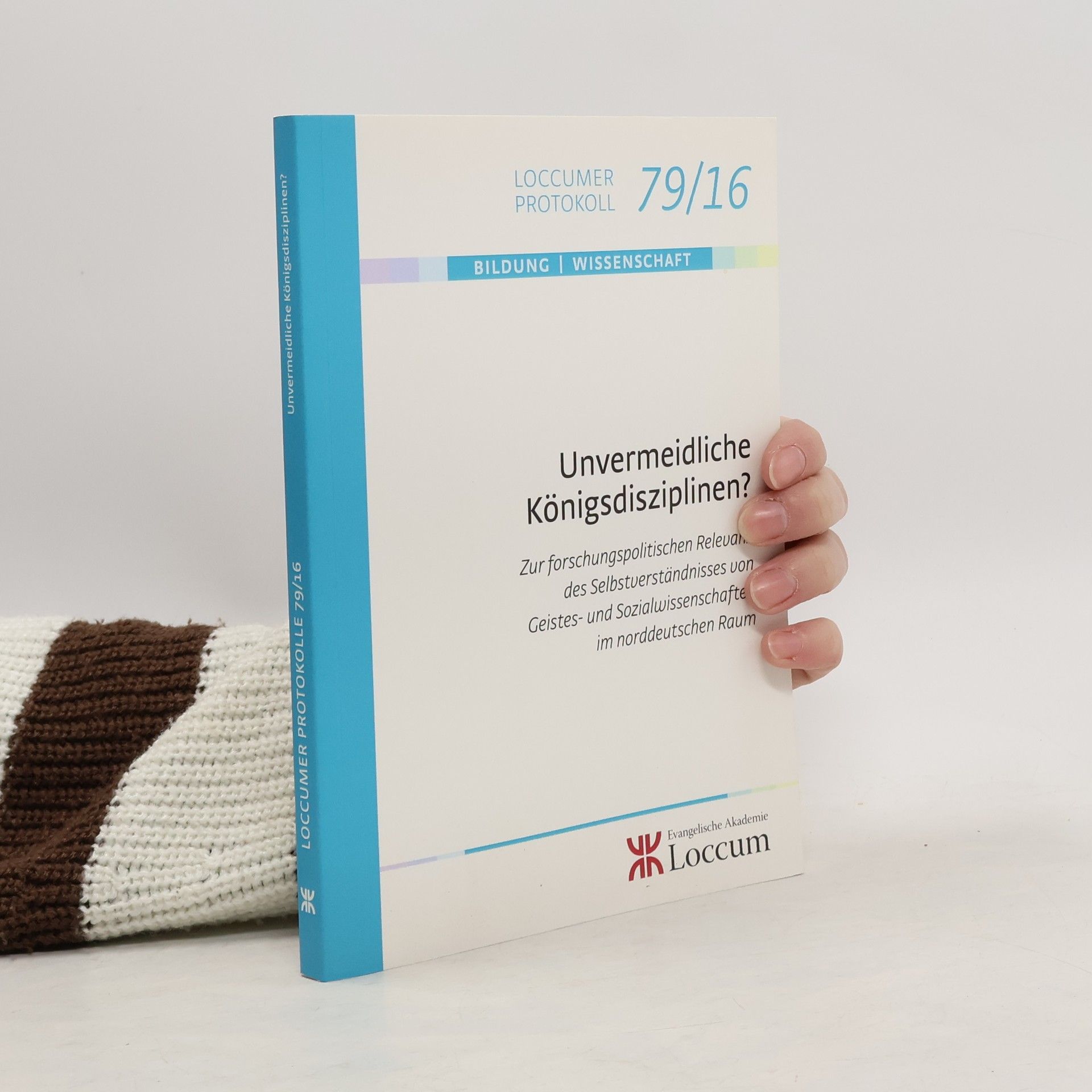
Zur forschungspolitischen Relevanz des Selbstverständnisses von Geistes- und Sozialwissenschaften im norddeutschen Raum