In den Beiträgen dieses Bandes werden die Bilder und Assoziationen, die mit neoliberale Metaphern transportiert werden, explizit gemacht und ihre Konnotationen und Ausblendungen kritisch beleuchtet. In der wirtschaftspolitischen Debatte wird mit Metaphern wie 'Rettungsschirm', 'schlanker Staat', 'soziale Hängematte', 'Leistungsträger' etc. versucht, gewisse Interpretationen und Wertungen ökonomischer Sachverhalte durchzusetzen, und damit bestimmte Maßnahmen zu legitimieren und andere zu diskreditieren. Dieses Buch bietet ein kleines Glossar der wichtigsten Metaphern im wirtschaftspolitischen Diskurs. Es sind zumeist solche, die ein neoliberales Weltbild und eine ebensolche Agenda transportieren. Das AutorInnenkollektiv liefert aber auch Beispiele für Metaphern und Bilder, die Wunschvorstellungen von einer emanzipativen Veränderung eine Form geben. Den Welterfindungs-Projektionen der Neoliberalen und der Unternehmen werden so alternative Bildproduktionen entgegengesetzt. Imagine Economy. differently!
Agnieszka Czejkowska Livres
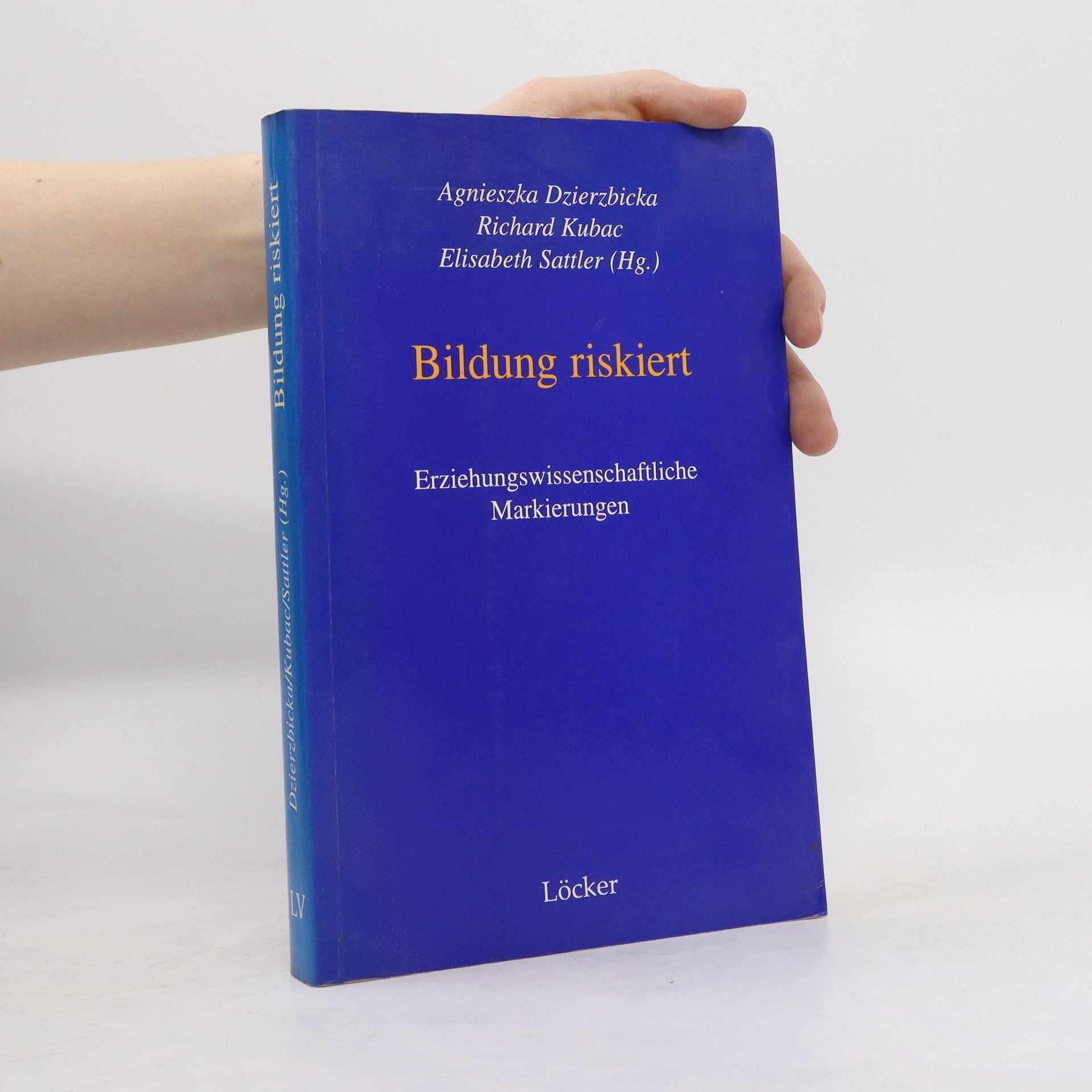


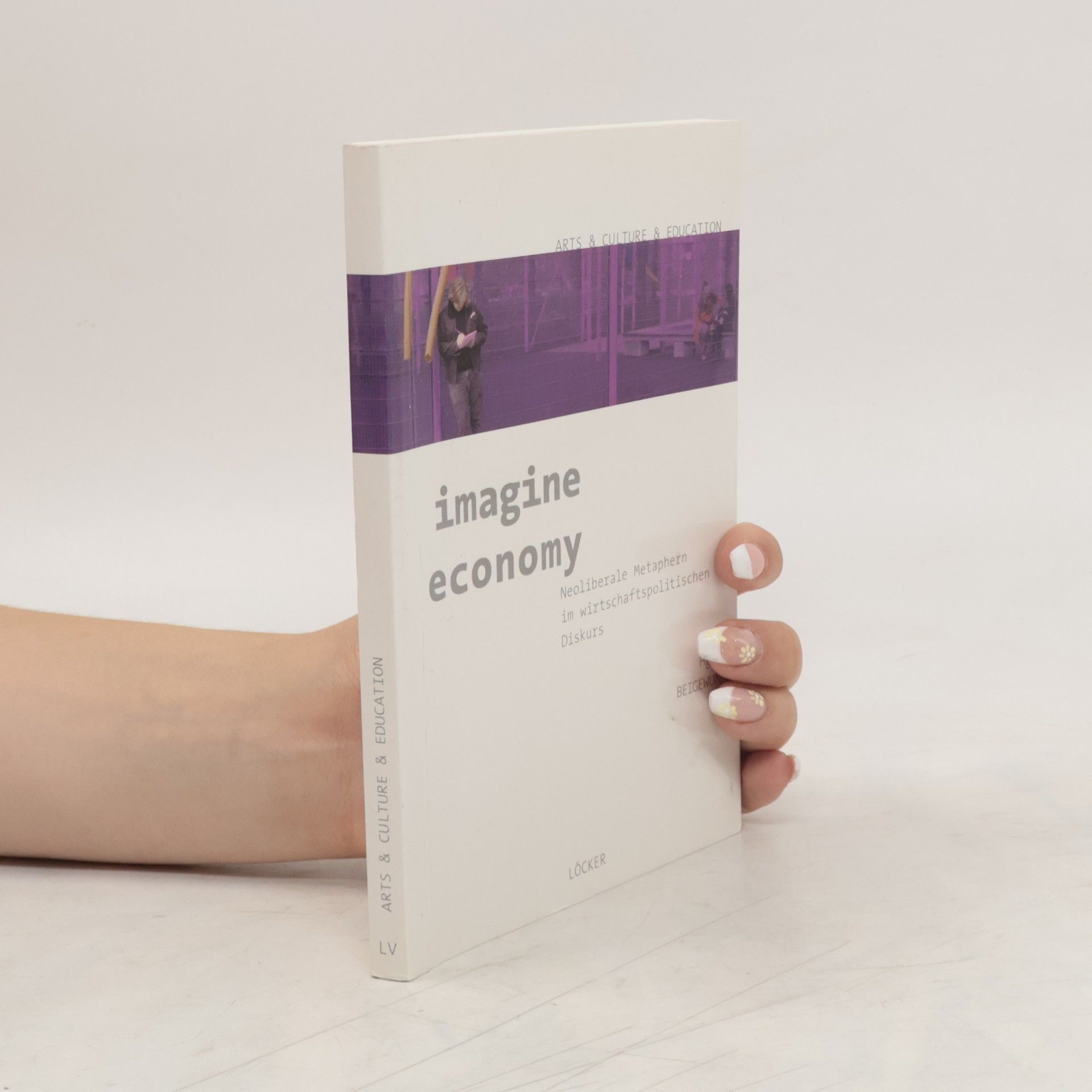
In bester Gesellschaft
Einführung in philosophischer Klassiker der Pädagogik
- 262pages
- 10 heures de lecture
Das vorliegende Buch versammelt philosophische Klassiker der Pädagogik. Ergänzt um bildungswissenschaftliche Kommentare und biographische Details finden die pädagogisch und bildungsphilosophisch interessierten Lesenden hier zentrale Textstellen und Gedanken eines Diogenes von Sinope oder Friedrich Nietzsche. An Hand von Originaltexten werden weiters Étienne de La Boétie, Immanuel Kant, Georg Wilhelm Hegel, Theodor W. Adorno oder Jean Baudrillard auf ihren Einfluss für pädagogisches Denken und Handeln heute diskutiert. Dabei kommen einführende aber auch bildungsphilosophische und wissenschaftsgeschichtliche Überlegungen zum Tragen, ebenso wie die Auseinandersetzung mit aktuellen gesellschaftspolitischen und disziplinären Herausforderungen. Mit kommentierenden Beiträgen von Josef Bakic, Ines M. Breinbauer, Agnieszka Dzierzbicka, Wolfgang Horvath, Richard Kubac, Konrad Paul Liessmann, Andrea Liesner, Astrid Messerschmidt, Norbert Meder, Konstantin Mitgutsch, Walter Müller, Christine Rabl, Jörg Ruhloff, Elisabeth Sattler, Gerhard Schaufler, Alfred Schirlbauer, Mona Singer und Reinhold Stipsits.
Politisch-gesellschaftliche Trendwenden ziehen pädagogische Veränderungen nach sich, die sich zunächst in einem veränderten Vokabular und neuen Neologismen zeigen. Die im bildungswissenschaftlichen Diskurs prägenden Schlagwörter werden in prägnanten Aufsätzen erläutert und kritisch analysiert. Dieses Wörterbuch der pädagogischen Gegenwartssprache orientiert sich am 2004 von Ulrich Bröckling et al. herausgegebenen 'Glossar der Gegenwart'. Es bietet bildungsinteressierten Lesenden eine kritische Auseinandersetzung mit Begriffen wie Autonomie, Bildungsstandards, Blended Learning, ECTS, PISA, Wissensmanagement und Qualitätsmanagement. Die Artikel klären Herkunft und Bedeutung dieser Elemente der pädagogischen Neusprache und beleuchten die damit verbundenen Entwicklungen und dramatischen Veränderungen im Bildungsbereich. Das Glossar versteht sich als Beitrag zur Untersuchung neuer ökonomischer Rationalitäten und Technologien zur Steuerung des Erziehungs- und Bildungswesens. Beiträge stammen von Fachleuten wie Ines Maria Breinbauer, Jutta Ecarius, Andrea Liesner, Konrad Paul Liessmann, Ludwig Pongratz, Jörg Ruhloff, Alfred Schirlbauer, Barbara Schneider und Roland Reichenbach.
Bildung riskiert
Erziehungswissenschaftliche Markierungen