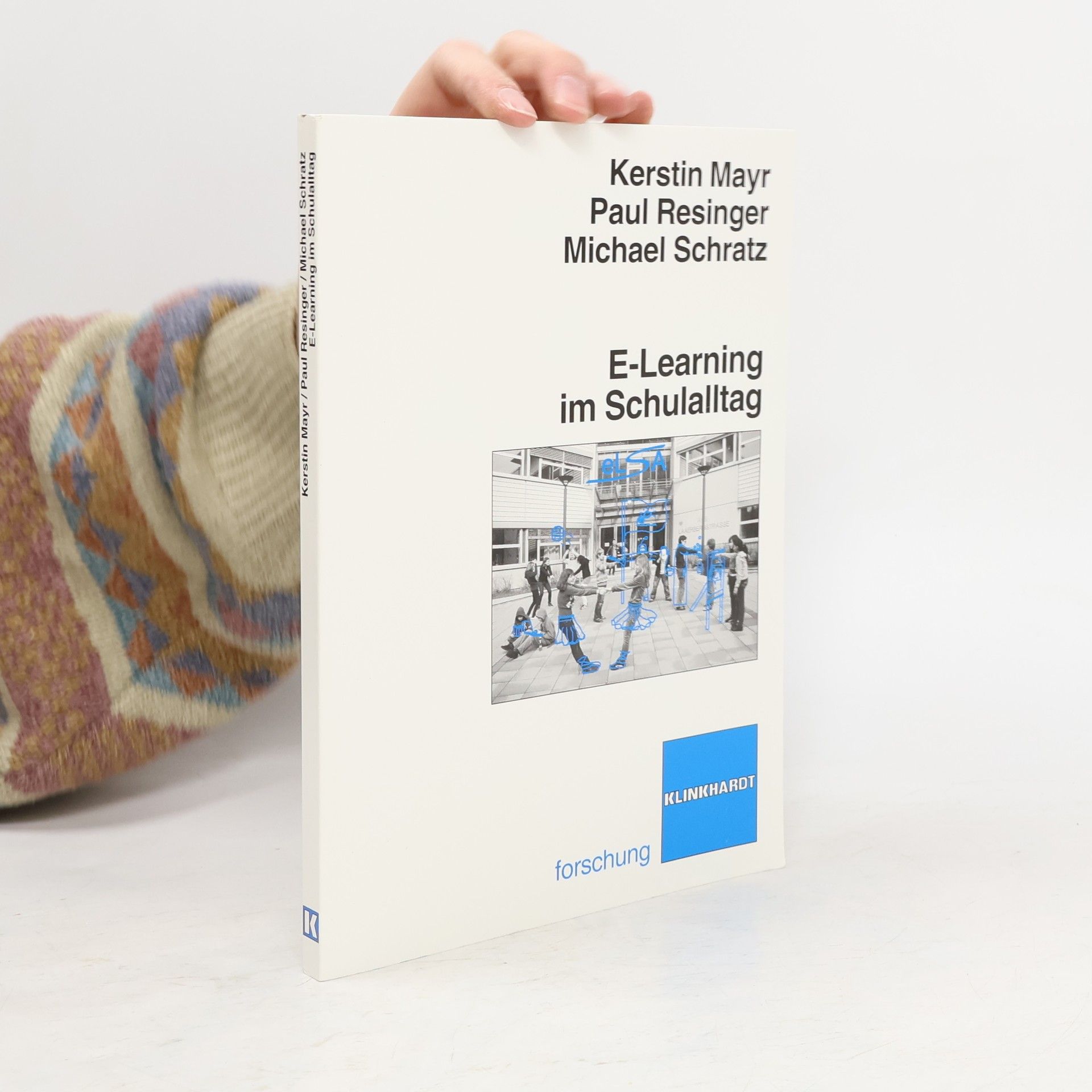E-Learning im Schulalltag
Eine Studie zum Einsatz moderner Informations- und Kommunikationstechnologien im Unterricht
- 160pages
- 6 heures de lecture
Die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) haben zu einem gesellschaftlichen Transformationsprozess beigetragen, der auch die Schule bewegt. Wissen wird freier verfüg- und abrufbar, womit die Lehrerinnen und Lehrer ihre Rolle als alleinige Wissensvermittler zusehends verlieren. Der herkömmliche orts- und zeitgebundene Unterricht wird durch asynchrone Lernphasen geöffnet, die das räumlich und zeitlich Verbindende gemeinsame Lernen auflösen.Für die Lehrenden ist der Unterricht mit neuen IKT daher eine große Herausforderung. Nach den notwendigen technischen Kenntnissen erfordert es besondere didaktische und pädagogische Kompetenzen. Die Vorbereitung von Unterricht in einer elektronischen Landschaft ist aufwändig, setzt gute Medienkenntnisse voraus und erfordert methodisch-didaktische Kreativität. Dieses Buch gibt Einblicke in ein Forschungsprojekt, das die Erfahrungen von Schulen analysiert, wie alle Lehrerinnen und Lehrer einer Schule gewonnen werden können, mit den neuen Informationstechnologien im Unterricht zu experimentieren. Fünf Fallstudien geben detaillierte Einblicke, wie Lehrpersonen die notwendigen technischen Kenntnisse und besonderen didaktischen und pädagogischen Kompetenzen im Umgang mit den neuen Informations- und Kommunikationstechnologien im täglichen Unterricht erwerben. Darüber hinaus werden jene Erkenntnisse herausgearbeitet, die über den einzelnen Fall hinaus von Bedeutung sind sowie Empfehlungen zur Einführung von E-Learning im Schulalltag abgeleitet.