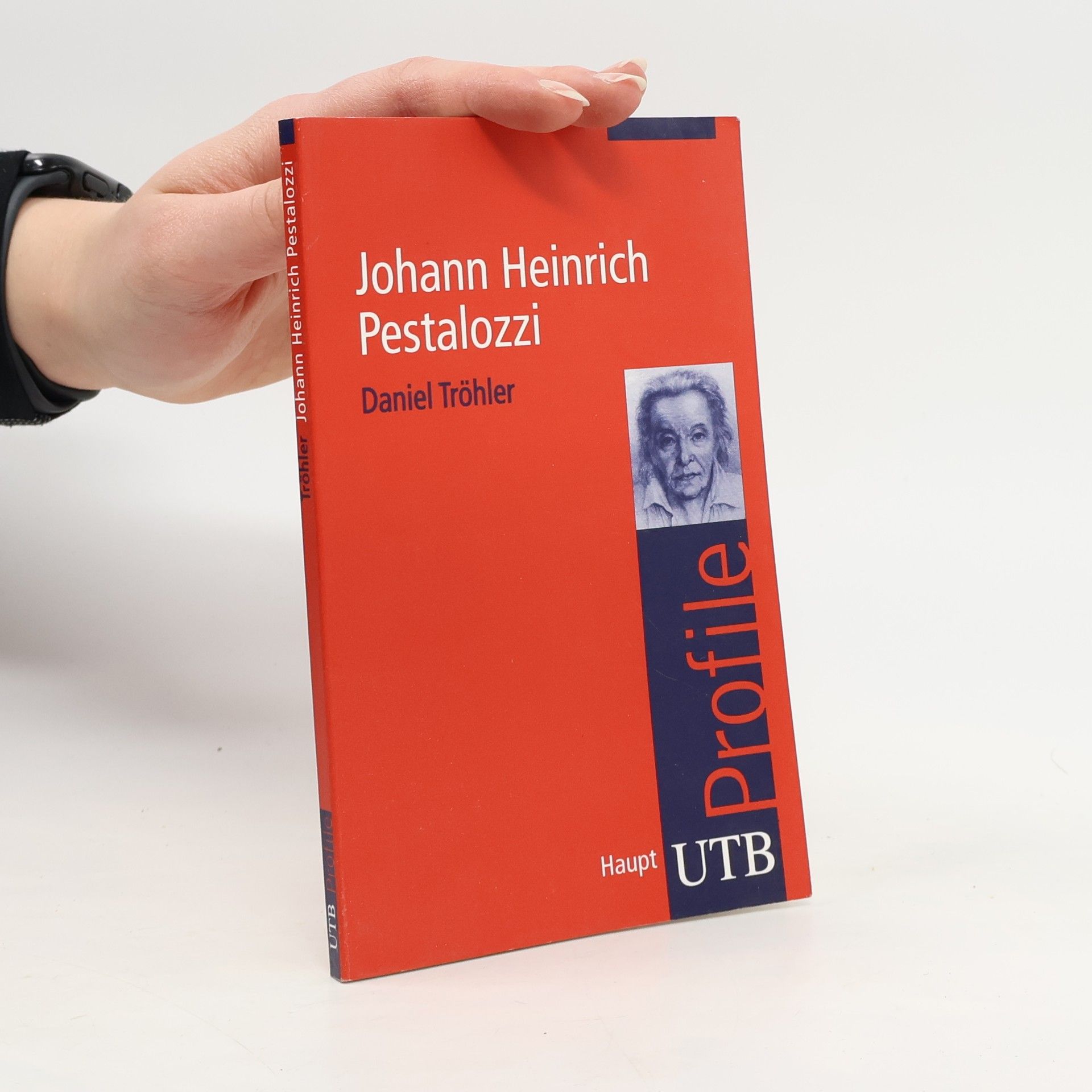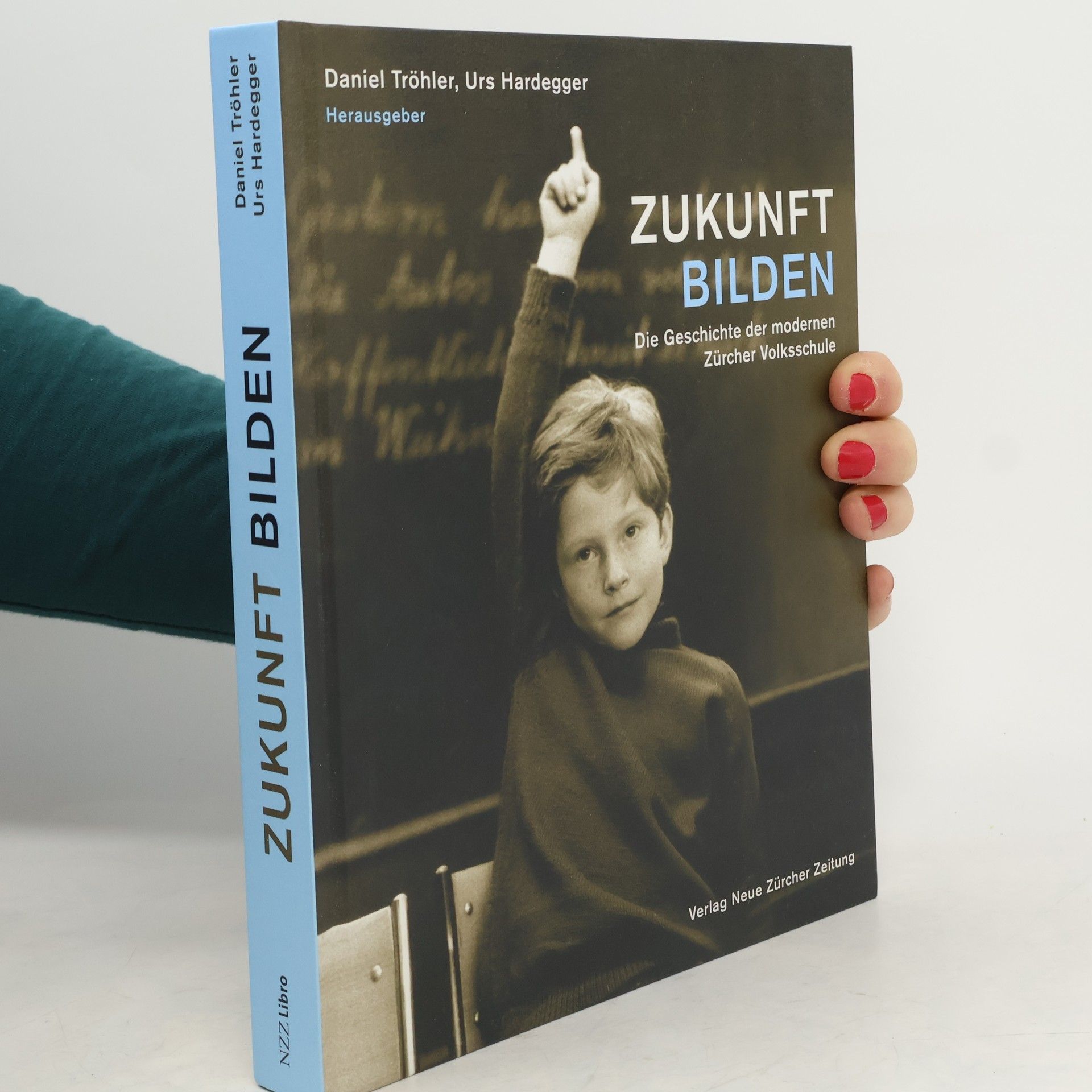Zukunft bilden
Die Geschichte der modernen Zürcher Volksschule
An 14 spannenden Themen wird die Geschichte und die Entwicklung der Volksschule nachgezeichnet. Ob Lehrmittel, Lehrplan, Feminisierung, Standespolitik, Religion, Architektur oder Verwaltung, alle interagierenden Aspekte des Bildungssystems werden übersichtlich und auch für Laien verständlich dargestellt, ohne den wissenschaftlichen Anspruch preiszugeben. Es wird aufgezeigt, wie eng der Wandel der Schule von 1832 bis 2007 an gesamtgesellschaftliche und kulturelle Entwicklungen geknüpft ist und wie in den einzelnen Segmenten der Schulpraxis auf Reformen und Reformversuche reagiert wird. Der historische Blick auf die Reformierbarkeit der Schule macht das Buch zur unentbehrlichen Grundlage und zu einem wertvollen Nachschlagewerk für die an der Schule interessierte Öffentlichkeit, die Bildungsverwaltung, die Bildungspolitik und vor allem auch für die Lehrpersonen.