"Das vom Anwender als eher statische Materie wahrgenommene Sachenrecht wurde für die Neuauflage gründlich durchgesehen und auf den aktuellen Stand gebracht. Neue Rechtsprechung und Literaturnachweise sind eingearbeitet. Eine Besonderheit ist der systematische Überblick über die Rechtsprechung des BVerfG zum Eigentumsschutz und zur öffentlich-rechtlichen Entschädigung. Die Kommentierung des praxiswichtigen Wohnungseigentumsgesetzes liegt in einer aktualisiert vor. Erste Rechtsprechung nach der Reform durch das WEMoG ist eingearbeitet.Die Kommentierung des Nießbrauchs legt einen Schwerpunkt auf praxiswichtige steuerrechtliche Details. Grundlegend überarbeitet ist das Recht der Sicherungsübereignung unter Berücksichtigung der jüngsten höchstrichterlichen Rechtsprechung.Ausführlich erläutert ist ferner das Erbbaurechtsgesetz." -- Provided by publisher
Reinhard Gaier Livres
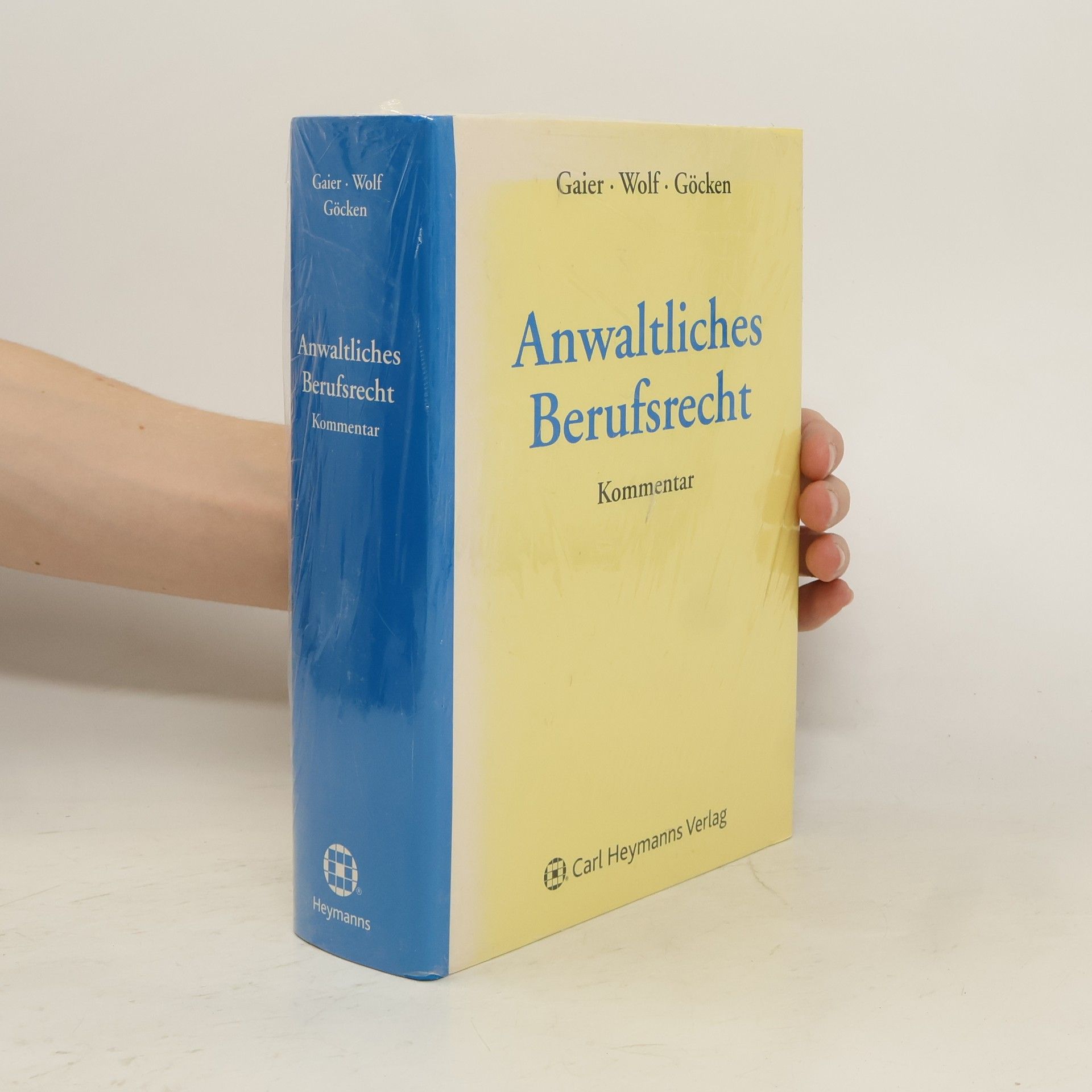

Anwaltliches Berufsrecht
- 2268pages
- 80 heures de lecture