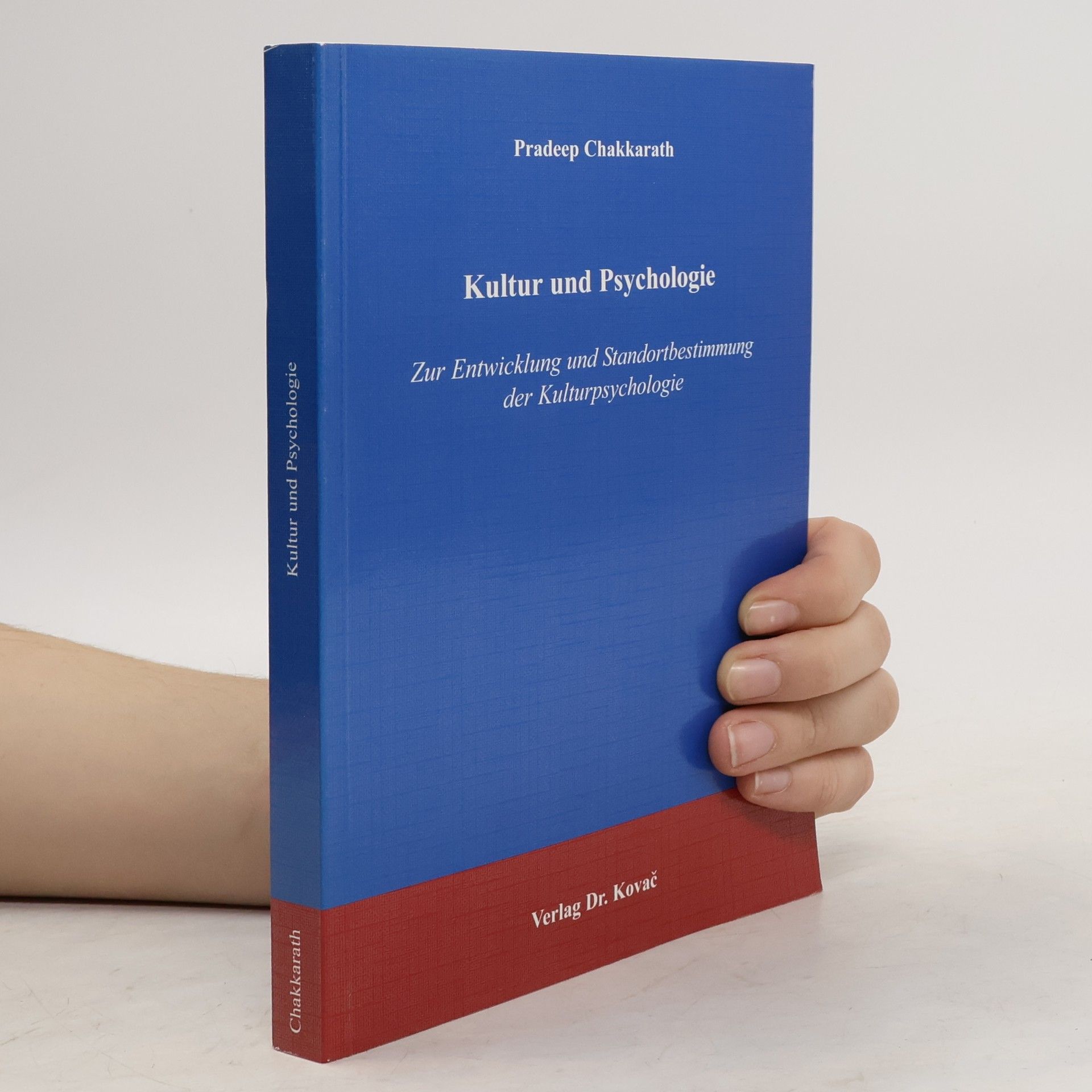Schriften zur Kulturwissenschaft: Kultur und Psychologie
Zur Entwicklung und Standortbestimmung der Kulturpsychologie
- 316pages
- 12 heures de lecture
Das Buch zeigt Defizite in der Historiographie zur Integration des Themas „Kultur“ in die Psychologie auf und strebt an, einige davon zu beheben. Es wird festgestellt, dass die Kulturpsychologie oft als Produkt der Moderne betrachtet wird, ohne erkennbare Konturen in früheren Epochen. Dies hängt mit dem Selbstverständnis der modernen Psychologie zusammen, die als naturwissenschaftlich orientierte Disziplin gilt, die erst im 19. Jahrhundert entstand. Die reservierte Haltung der Psychologiehistoriker gegenüber der Vergangenheit ist daher wenig überraschend. Die Gründe für diese Defizite sind vielfältig: von einer unzureichenden Aufarbeitung klassischer Quellen der europäischen Geistesgeschichte über ethnozentrische Bewertungen vergangener Leistungen bis hin zu unzureichender Beachtung außereuropäischer, insbesondere indigener psychologischer Beiträge. Der Autor ist sich bewusst, dass er nicht alle Defizite beseitigen kann, möchte jedoch die Aufarbeitung relevanter Quellen fördern. Er erkennt an, dass auch er ethnozentrischen Wertungen unterliegen könnte, und möchte auf deren Einfluss in bisherigen Darstellungen hinweisen. Zudem konzentriert er sich vorwiegend auf europäische Beiträge, zielt jedoch darauf ab, durch die Identifizierung und Rehabilitierung alter theoretischer und methodischer Konzepte zur Rekonstruktion von Ansätzen außerhalb Europas und vor der „Europäisierung“ der Wissenschaften zu ermutigen.