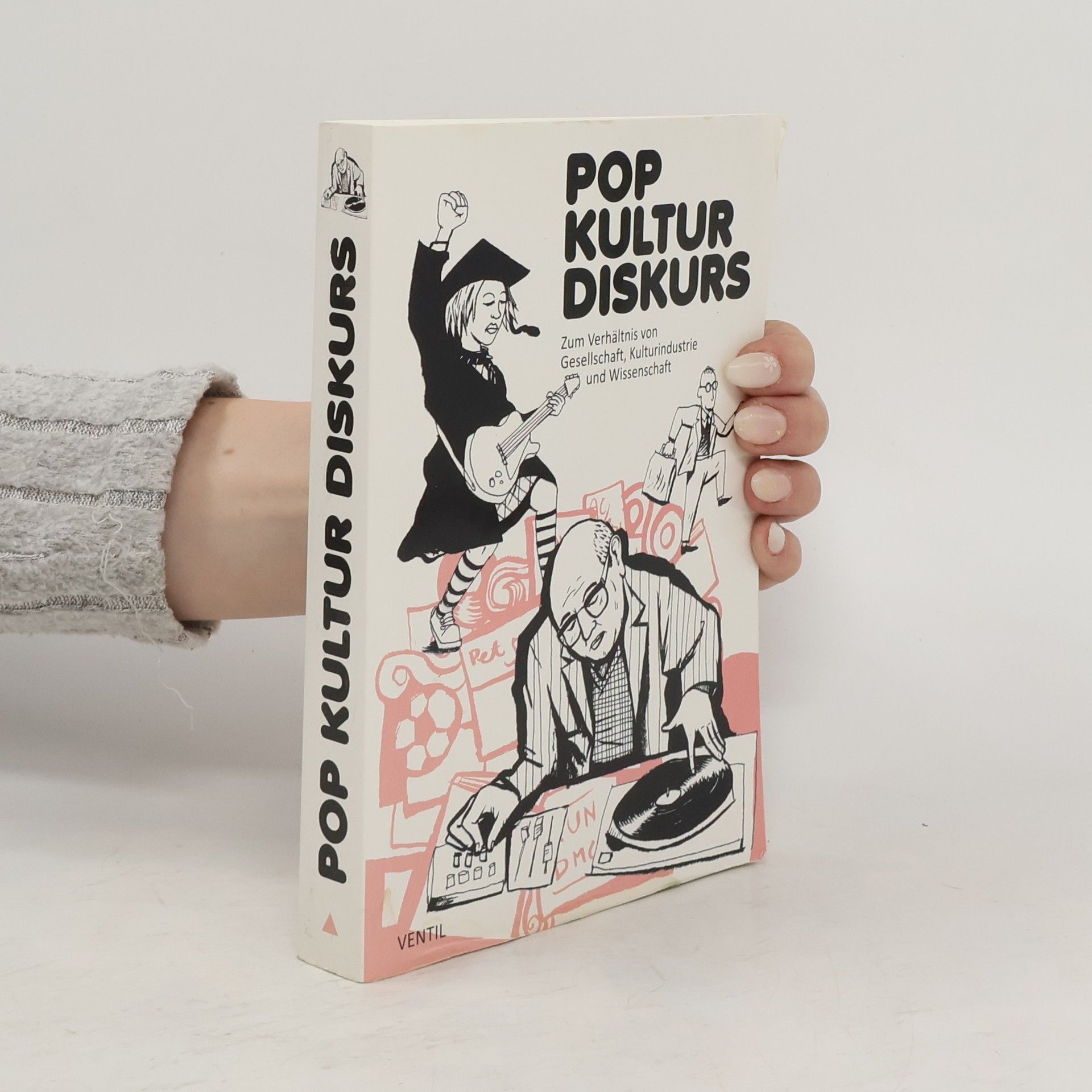testcard #27: Rechtspop
Beiträge zur Popgeschichte
Zukunft statt Vergangenheit, bunt statt braun, Plastik statt Kruppstahl, Spiel statt Arbeit, Mode statt Uniform, Witz statt Härte, Love statt Hass, Individualismus statt Volksgemeinschaft, Sexyness statt Männlichkeit, Rock’n’Roll statt Gleichschritt, Cool statt Kälte … Pop entstand aus den Trümmern von Faschismus und Krieg, mit dem Ziel, eine bessere Welt zu schaffen und das Leben für alle "different and appealing" zu gestalten. Doch irgendwann nahm Pop einen scharfen Rechtskurs – die neue Ausgabe der testcard untersucht die Ursachen. Faschismus repräsentierte eine geschlossene Gesellschaft des Gehorsams, während Pop als antifaschistische Kultur galt, ohne den Antifaschismus explizit zu benennen. In den 1950ern kam Pop aus den USA nach Europa und versprach eine offene Gesellschaft, die Jugendlichen Ungehorsam und Selbstentdeckung ermöglichte. Heute hat die Rechte den Pop für sich reklamiert. Wie kam es zu dieser Bedeutungsentwertung der Popkultur? Diese Frage wird in zahlreichen Artikeln behandelt, darunter Themen wie rechte Frauen in der Popkultur, Menschenfeindlichkeit in rechter Meme-Culture, Filme von Steve Bannon, Diktatorenromane, Selbstoptimierung statt Solidarität, und die Identitäre Bewegung.