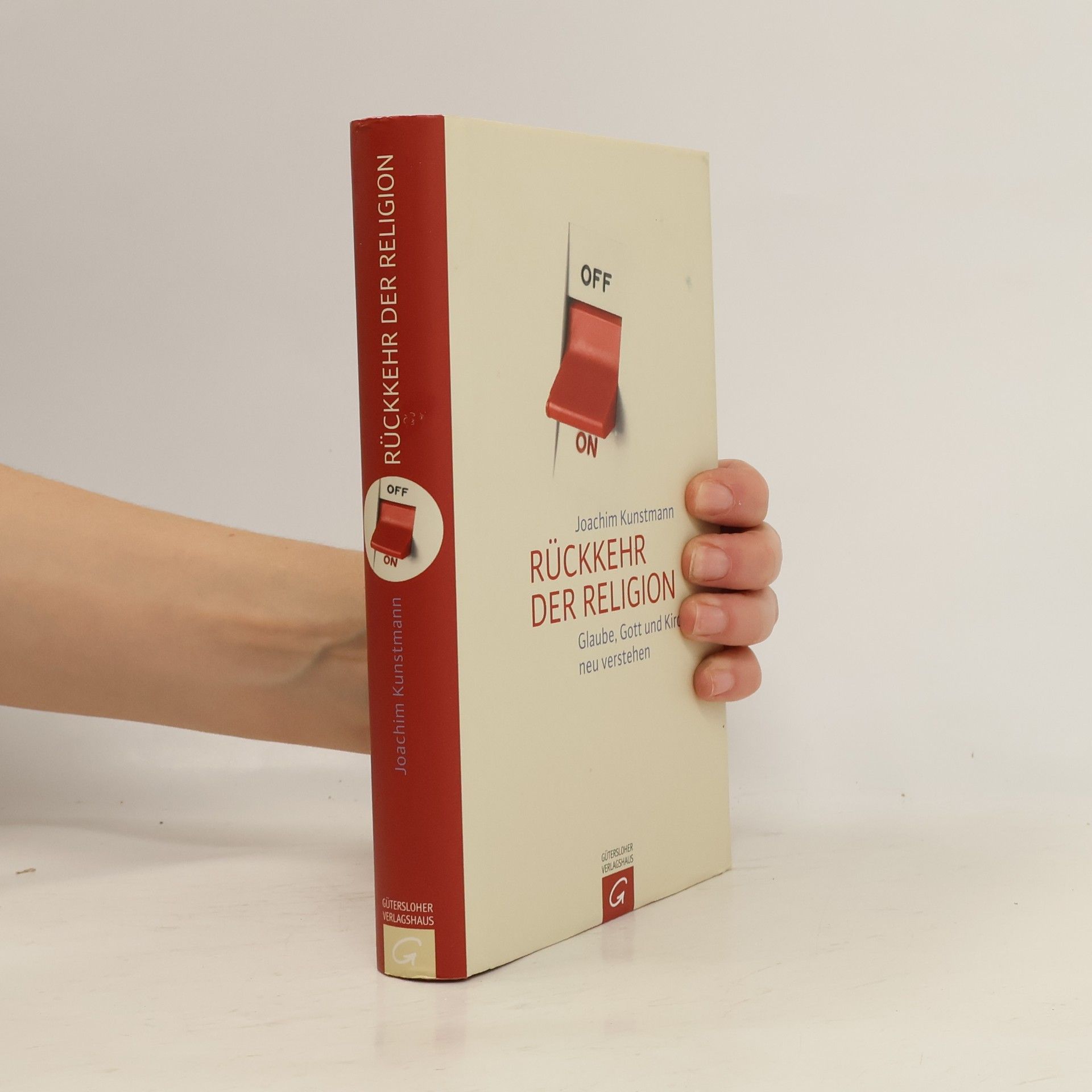Religionspädagogik
Einführung und Überblick
Kunstmanns nun in aktualisierter Auflage vorliegende Einführung bietet einen umfassenden Überblick über sämtliche Arbeitsfelder einer zeitgemäßen Religionspädagogik. Der Band behandelt die Grundfragen und traditionellen Themen des Faches, trägt aber auch neuesten Entwicklungen Rechnung, so der zunehmenden Hinwendung der Religionspädagogik zu Gegenwartsthemen wie der Individualisierung und Kulturbezogenheit von Religion, ferner zu ästhetischen Themen. Eine als strukturierend für alle klassischen Orte christlich-religiöser Erziehung, Sozialisation und Bildung ausgewiesene Religionsdidaktik ist ebenso in das Konzept integriert wie die Gemeindepädagogik. Das Buch ist somit ein unentbehrlicher Begleiter für Studium, Lehre und Gemeindearbeit.