Günter Dux Ordre des livres


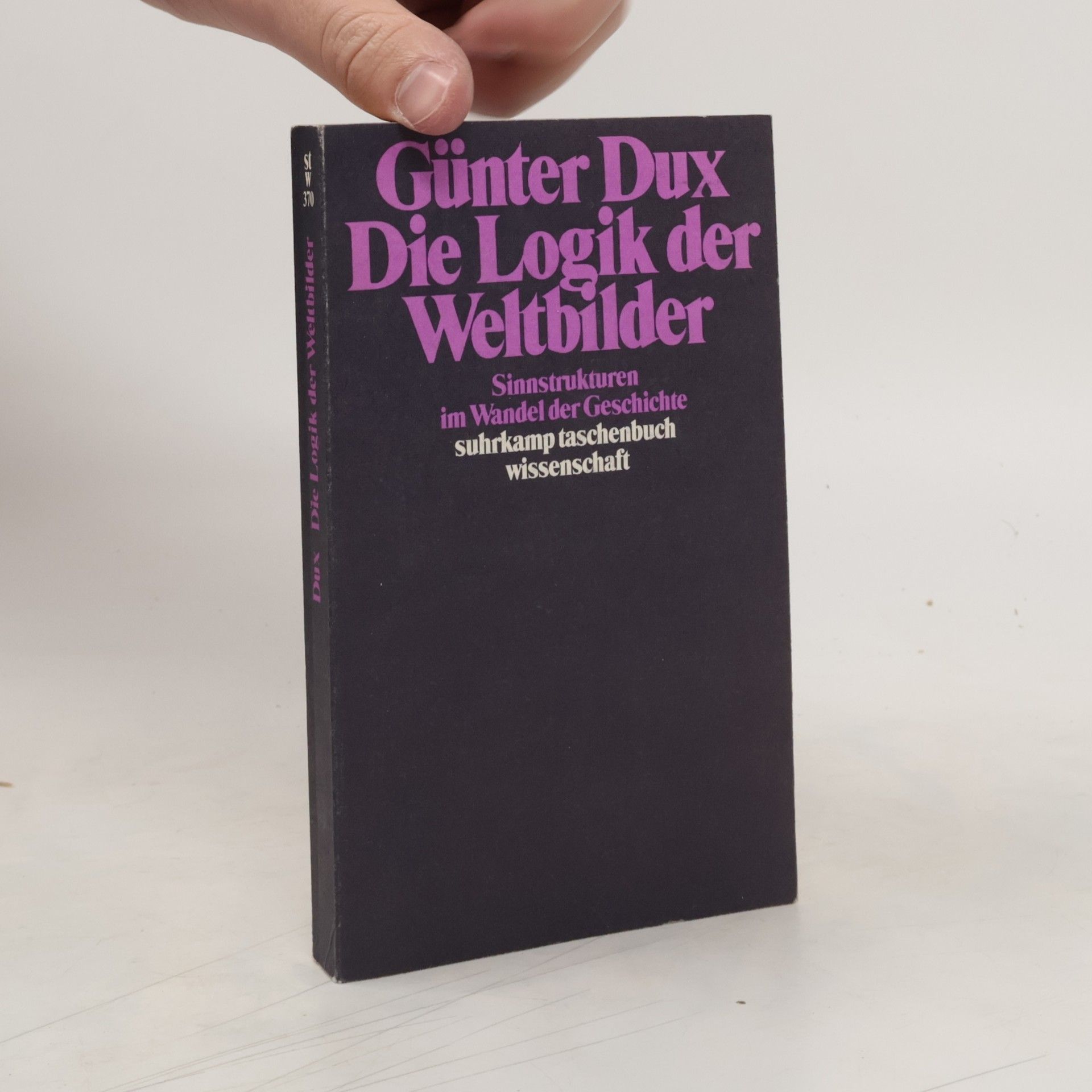
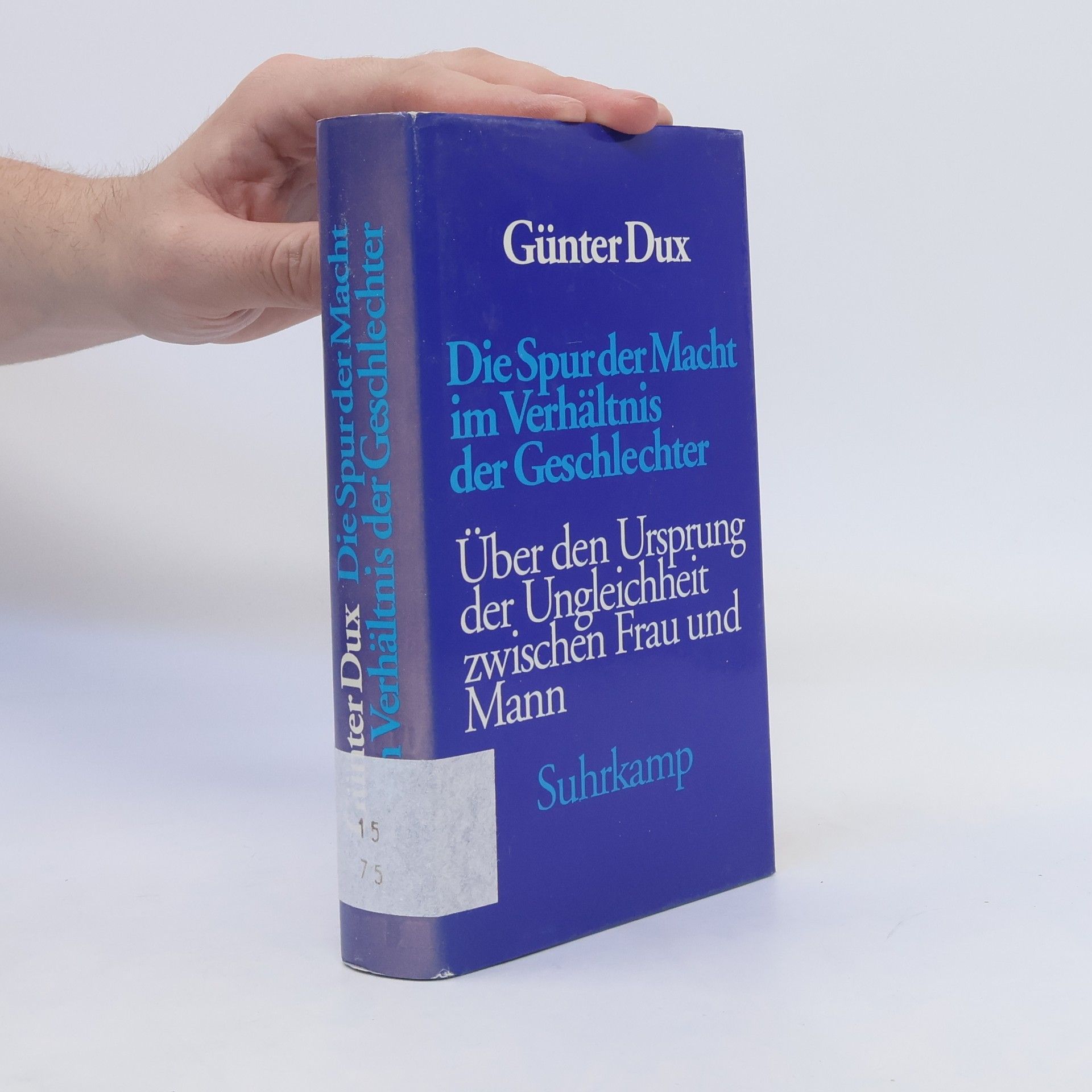
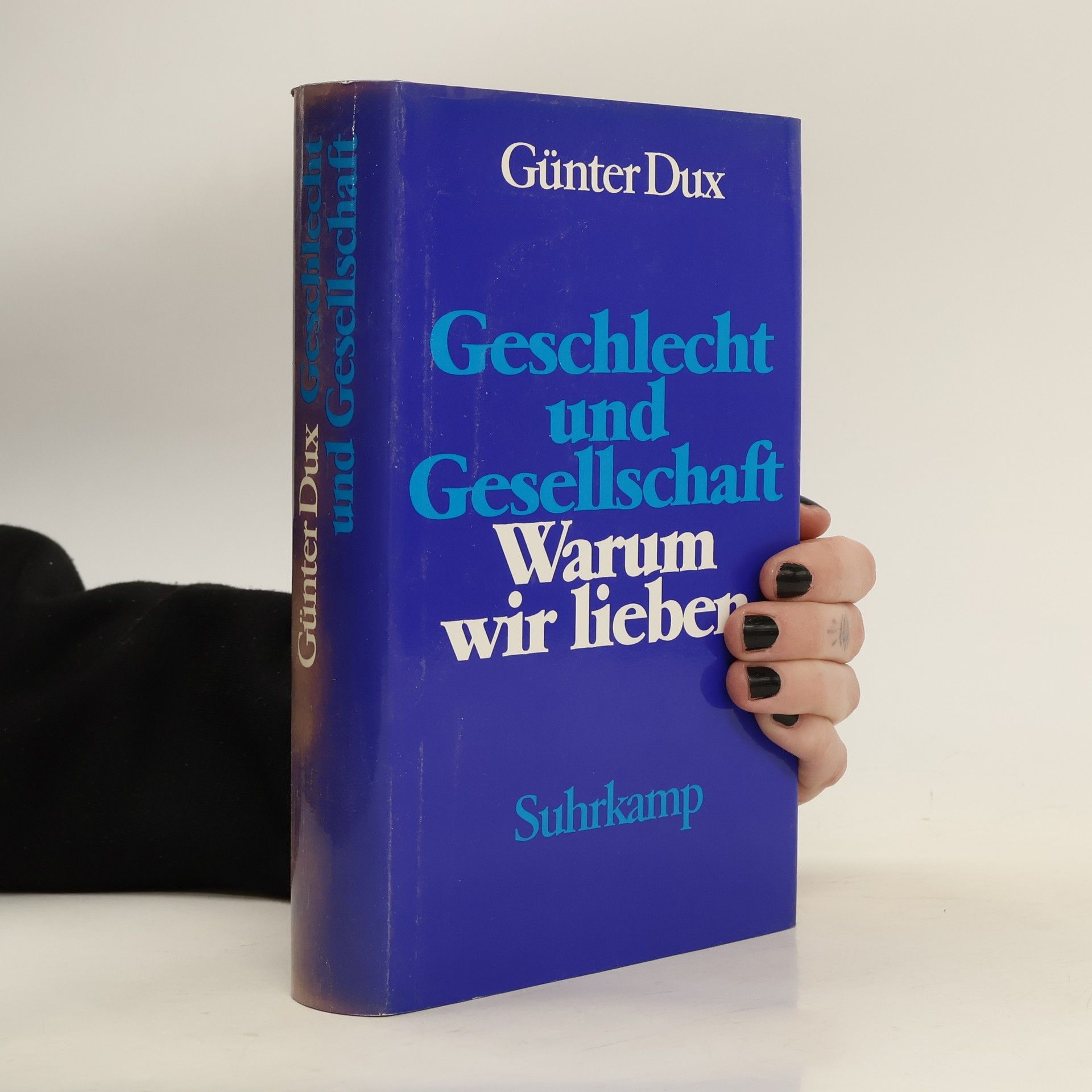

- 1994
- 1992
Durch die Jahrhunderte und die Jahrtausende zieht sich die Spur der Macht im Verhältnis der Geschlechter. Durch sie sind menschlichere Möglichkeiten des Daseins unterdrückt und zunichte gemacht worden. Wenn wir davon ausgehen müssen, daß zu allen Zeiten und in allen Gesellschaften die Geschlechter von dem Verlangen bestimmt waren, ihr Leben einander zu verbinden, und wenn wir berechtigt sind, dieses Verlangen in einem schlechterdings elementaren und nicht erst durch die Romantik bestimmten Sinne als Liebe zu bezeichnen, dann ist der Einschlag der Macht in das Verhältnis der Geschlechter widersinnig. Woher rührt er? Das ist die Frage, um deren Klärung es in diesem Buch geht.
- 1989
Die Arbeit über »Die Zeit in der Geschichte« verfolgt dieses doppelte Ziel: die Entwicklungslogik der Zeit aus einer Entwicklungslogik der Geschichte verständlich zu machen. Sie läßt sich deren Grundverständnis von dem historischen Bewußtsein der Gegenwart vorgeben: Geschichte ist für uns Gattungsgeschichte geworden. Wir schließen sie als Geschichte der geistigen, d. h. soziokulturellen Lebensformen an die Naturgeschichte an. Auch der Bildungsprozeß der Zeit muß deshalb als Anschlussform verständlich werden. Das ist das Ziel einer Erörterung über »Die Anthropologie der Zeit«.
- 1978
Rechtssoziologie
- 186pages
- 7 heures de lecture