Sibylle Plogstedt erkundet in ihrer Familiengeschichte, die bis ins 18. Jahrhundert reicht, verdrängte Erfahrungen und vergessene Schicksale. Sie reflektiert über den industriellen Aufstieg und die Krisen, das Erbe ihrer Mutter als Chefsekretärin hoher SS-Offiziere und das Schicksal ihres Onkels in Stalingrad. Misstrauen und Opfer prägen die Familiengeschichte.
Sibylle Plogstedt Livres

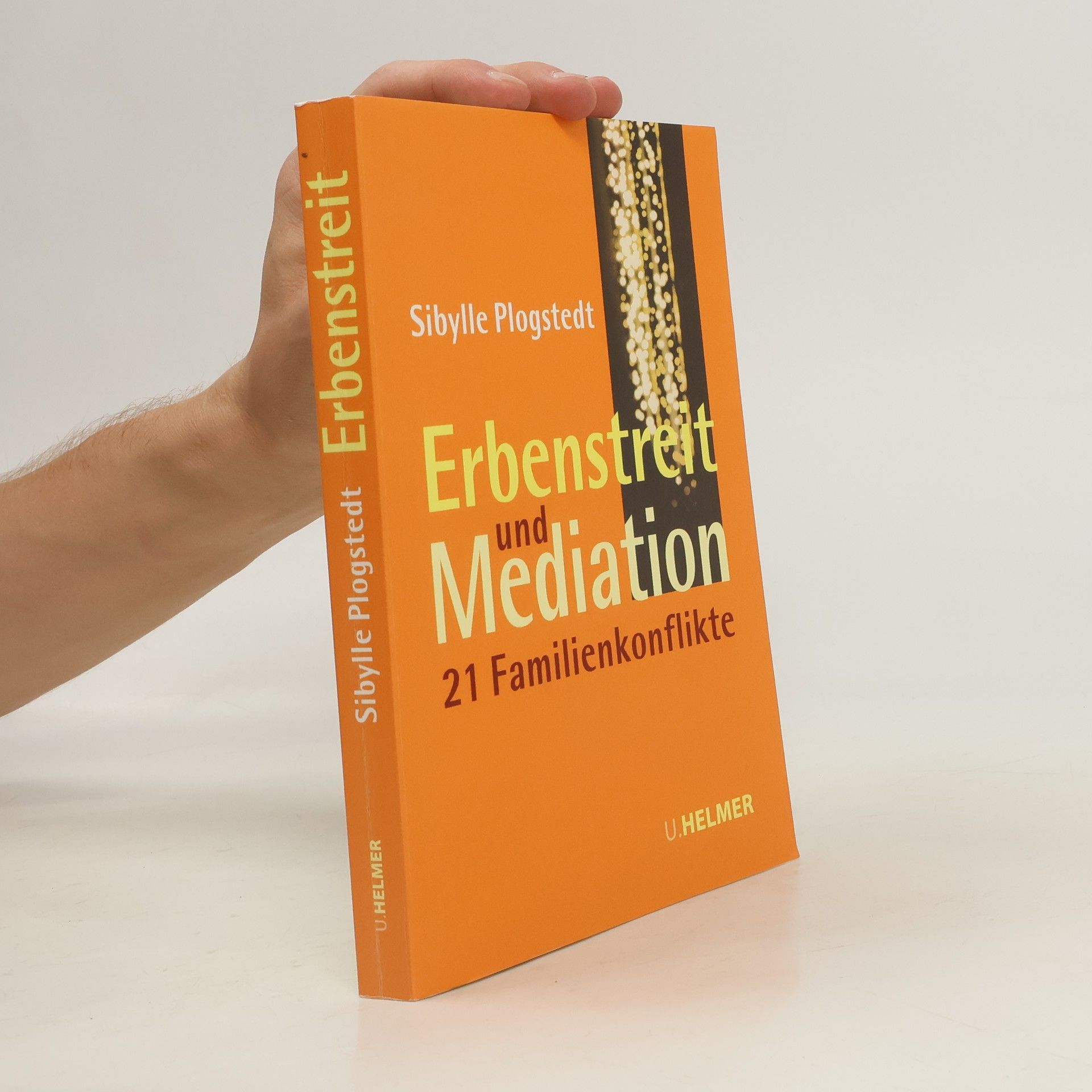
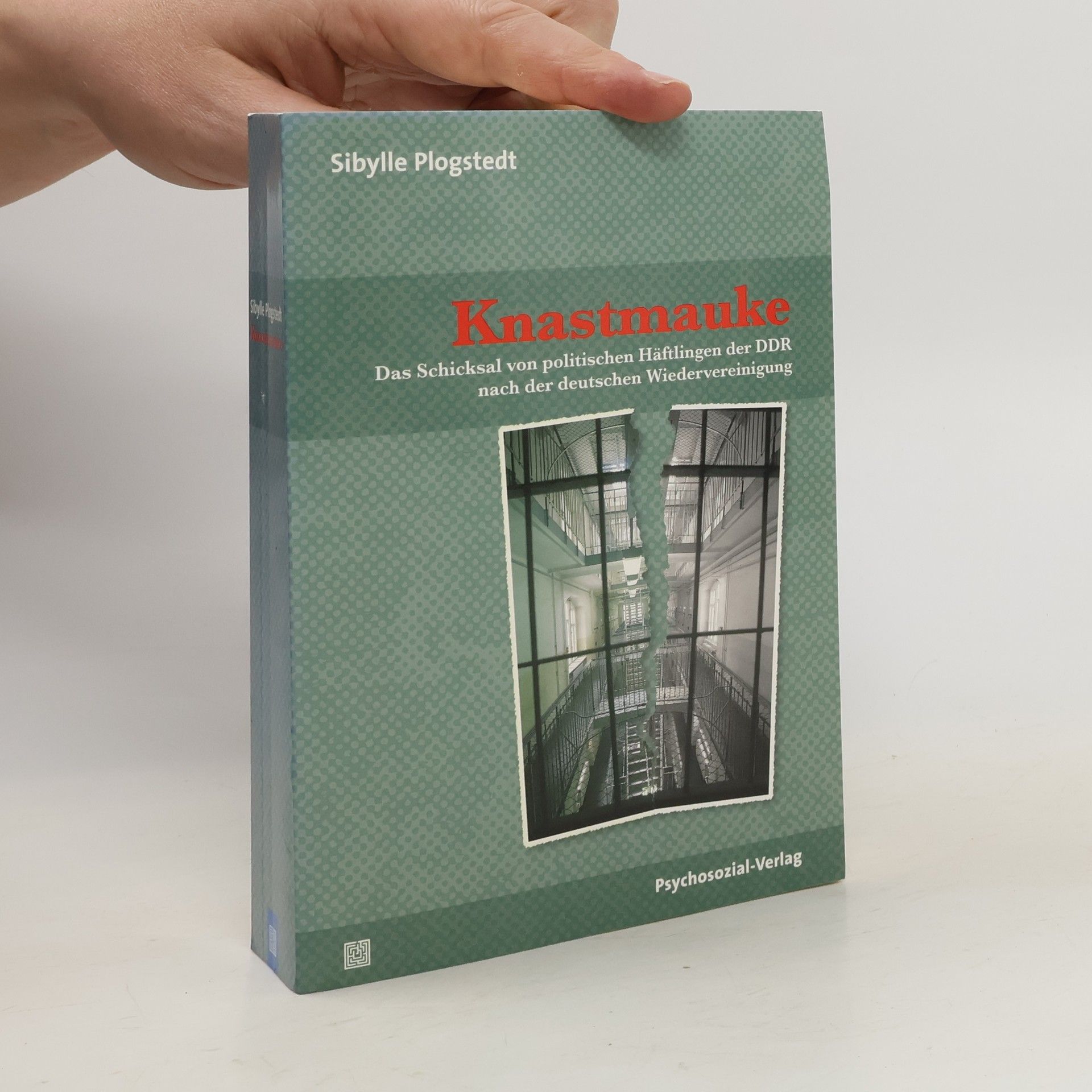
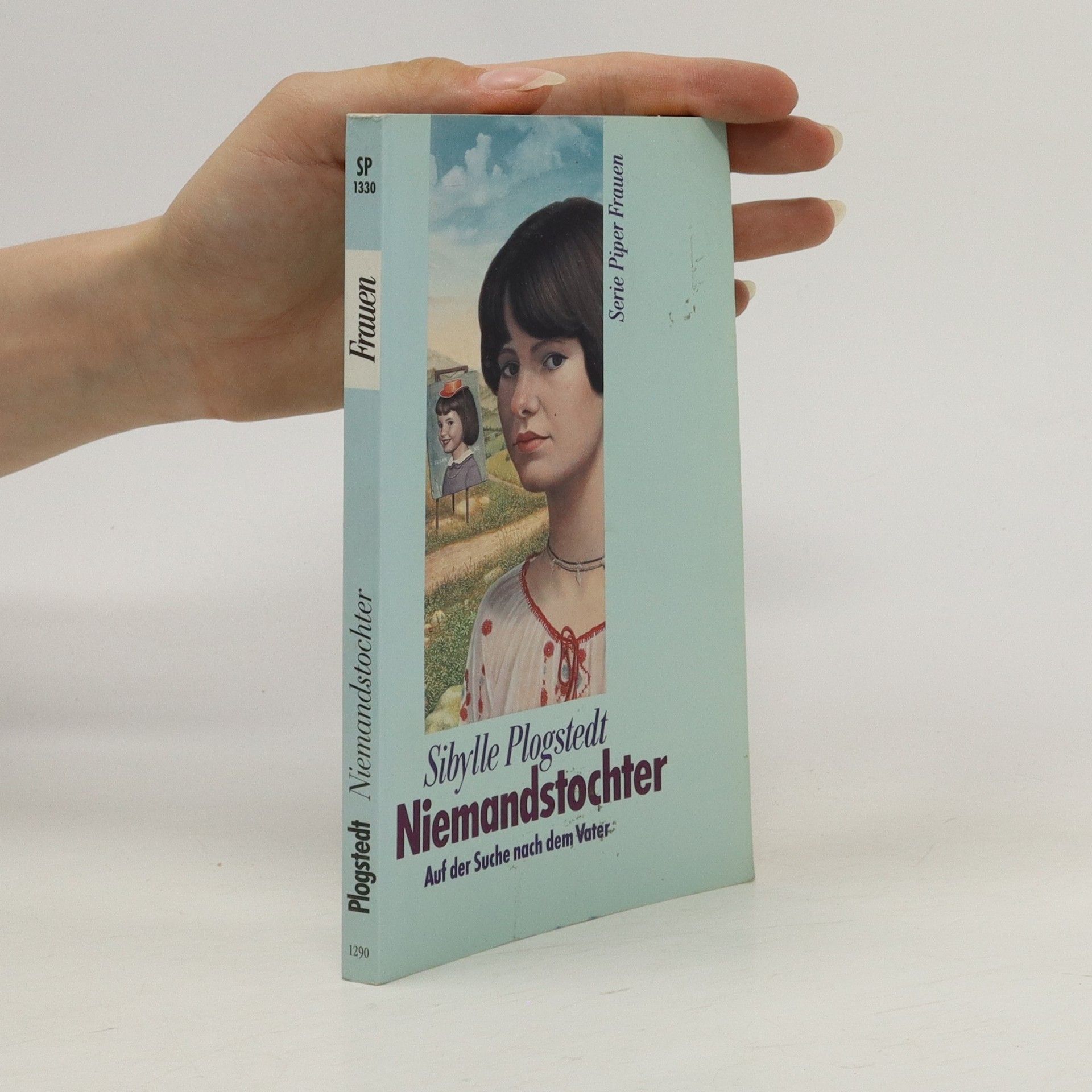
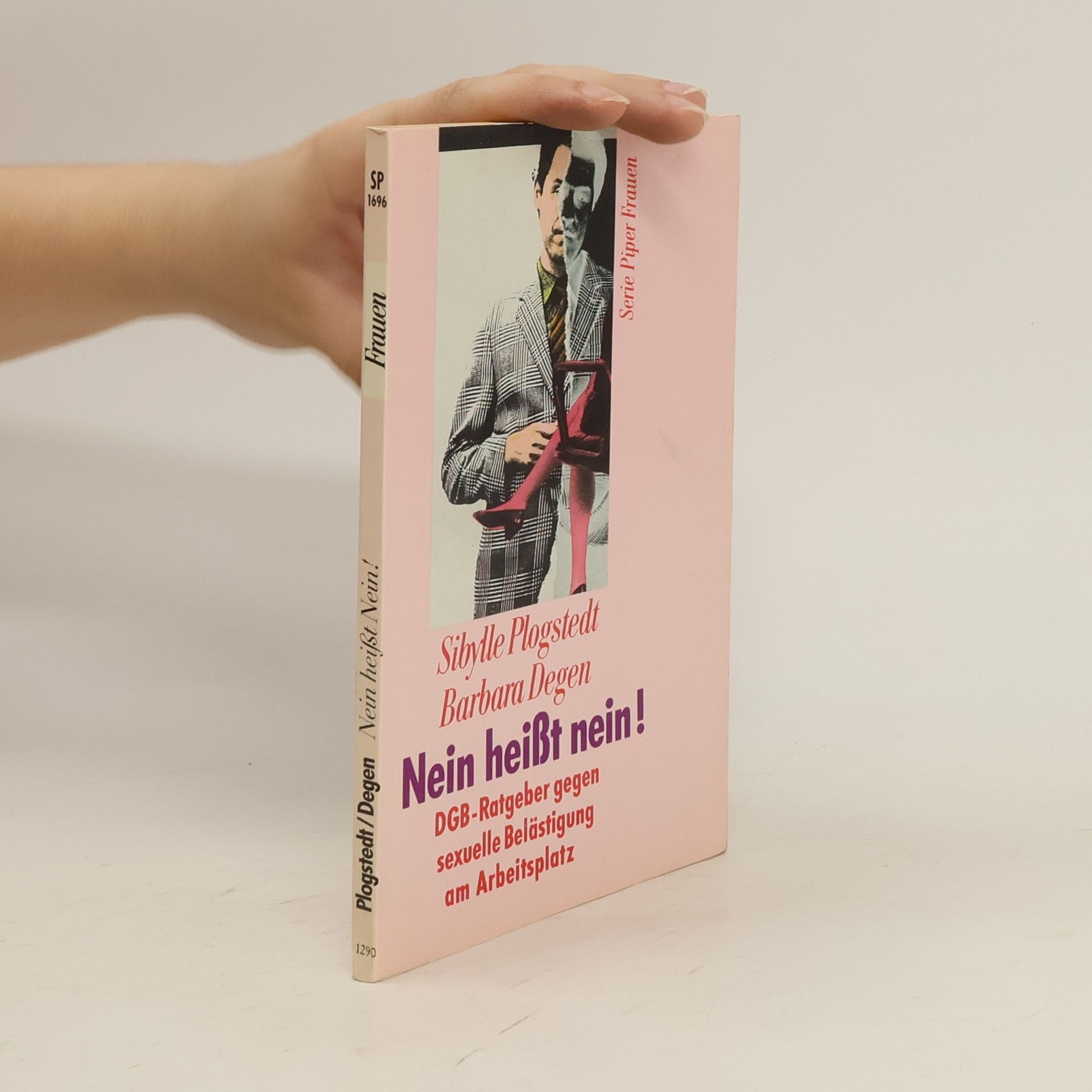

Informiert gut verständlich über den Tatbestand der sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz, seine juristische Behandlung, Probleme der Beweisführung u.a.m.
Das familiäre Schweigen über ihre vaterlose Kindheit war zentrales Lebensproblem der als aktive 68erin und Feministin bekannten Journalistin, bis sie den Mut fand, das Vater-Tabu zu brechen ..
Knastmauke
Das Schicksal von politischen Häftlingen der DDR nach der deutschen Wiedervereinigung
Der wissenschaftliche Teil des Buches, reich an Daten, Tabellen und Schaubildern, wird durch seine lesbare und konkrete Darstellung der Sachverhalte ergänzt. Während frühere Studien oft auf weniger Teilnehmer oder regionale Schwerpunkte beschränkt waren, bietet Sibylle Plogstedt eine umfassende Analyse. Sie untersucht das Schicksal von rund 200.000 politischen Gefangenen der DDR und besucht 25 von ihnen. Dabei zeigt sich, dass die einstigen Heldinnen und Helden heute in Armut leben. In der DDR erlitten sie Berufsverbote, Haft und psychische Folter, und ihre Lebensbedingungen haben sich kaum verbessert. Fast die Hälfte von ihnen muss mit weniger als 1.000 Euro im Monat auskommen, Frauen sogar mit noch weniger. Etwa 13 Prozent beziehen Hartz IV und kämpfen mit psychischen Traumata, die bis zu Suizidversuchen führen können. Diese Ergebnisse stammen aus einer Studie an 802 Häftlingen. Die Vorkämpfer der Deutschen Einheit hatten sich nach der friedlichen Revolution eine andere Realität erhofft, doch nach 1989 fehlten ihnen die Kraft und die Möglichkeit, ihre Wünsche umzusetzen. Plogstedts Fazit verdeutlicht, dass die heutige Armut der ehemaligen Häftlinge eine Folge dieser Traumata ist.
Erbstreit ist ein Familientabu, das viele betrifft, aber nur wenige ansprechen. Der Verlust des Erbteils ist eine extreme Kränkung, und Erben birgt Risiken, während Gier oft zu Konflikten führt. Ein Drittel aller Erbschaften ist strittig, und der Anteil steigt. In diesem Kontext kommt es häufig zu Lügen und Betrug, sei es durch gefälschte Testamente oder leere Konten. Alte Konflikte brechen wieder auf, besonders wenn die Eltern, die zuvor als Puffer agierten, nicht mehr da sind. Trauer kann den Streit verstärken, da Wut oft die Trauer überlagert. Geschwister, die gegeneinander prozessieren, riskieren dauerhafte Feindschaften und jahrzehntelange Kontaktvermeidung. Sibylle Plogstedt hat in Familienbetrieben und Handwerksstätten schreckliche Fälle von Erbstreit erlebt und mit Erbmediatoren sowie Beratern gesprochen, die Lösungen anbieten. Anhand von Beispielen aus Mediation und Therapie zeigt sie, wie Erben ohne den Verlust familiärer Bindungen gestaltet werden kann. Wer den Kontakt zu Verwandten und das wirtschaftliche Wohlergehen des Betriebs wahren möchte, sollte frühzeitig auf 'sanftes Erben' setzen. Erben kann gelernt werden, und dieses Buch bietet wertvolle Einblicke.
Autorka byla ve svých čtyřiadvaceti letech zatčena československou Státní bezpečností za aktivní opozici proti vpádu vojsk Varšavského paktu. Ve vazbě strávila jeden a půl roku. Dalších třicet let zůstává v zajetí svých vzpomínek, teprve pak dokáže čelit minulosti. Na svém vlastním příběhu líčí strhujícím stylem historii – od Pražského jara přes akce západoněmeckých levičáků z roku 1968 až k dnešním debatám o manipulaci se spisy Státní bezpečnosti.