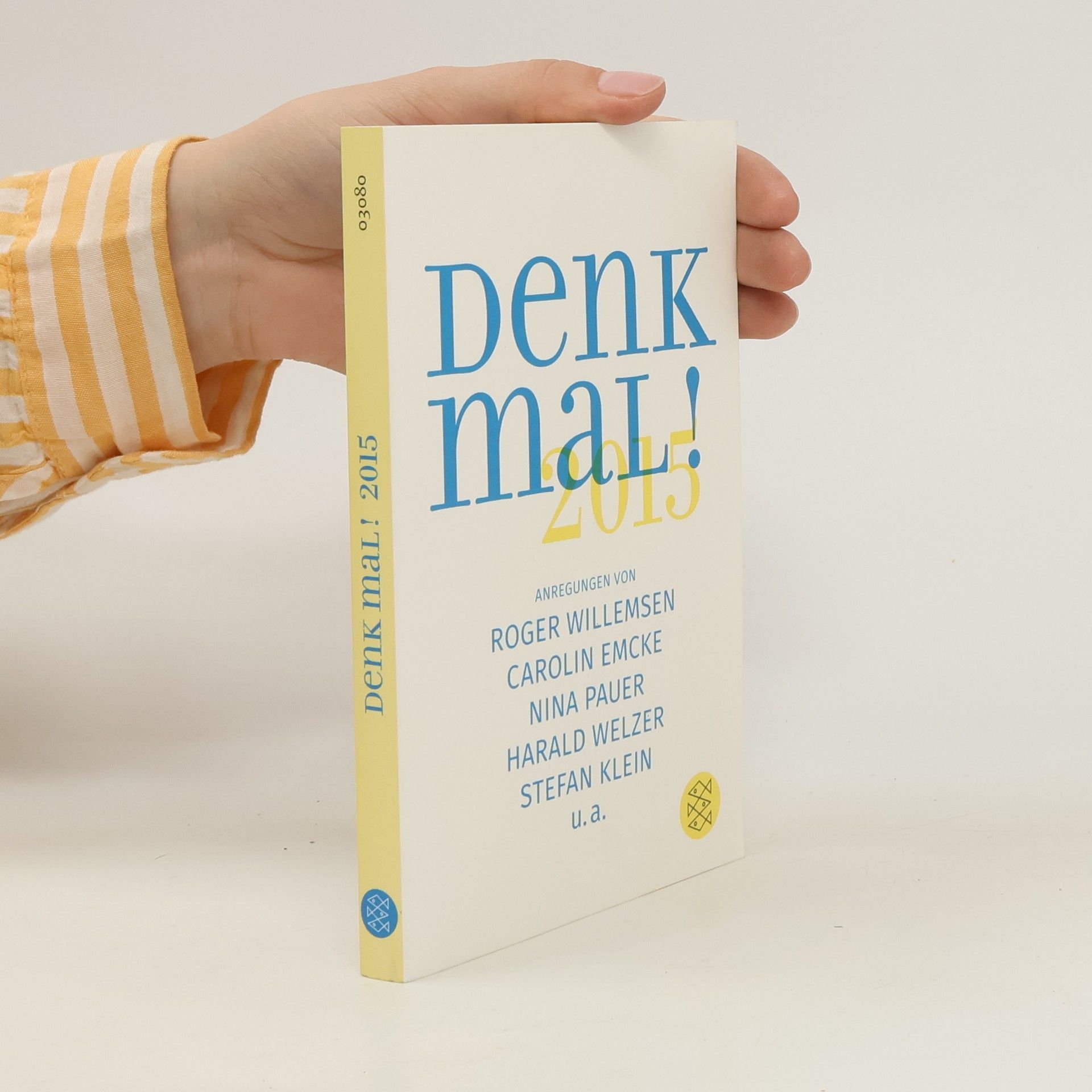Carolin Emcke Ordre des livres (chronologique)
Carolin Emcke est une auteure dont le travail explore des questions sociétales profondes telles que l'identité, la violence et la haine. Son style journalistique se caractérise par une analyse incisive et une capacité remarquable à relier la réflexion personnelle à des considérations politiques et philosophiques plus larges. Emcke aborde fréquemment des thèmes tels que le racisme, le fanatisme et les menaces à la démocratie, incitant les lecteurs à réfléchir aux complexités de la société contemporaine. Son écriture est à la fois pénétrante et accessible, offrant un aperçu des défis cruciaux de notre époque.
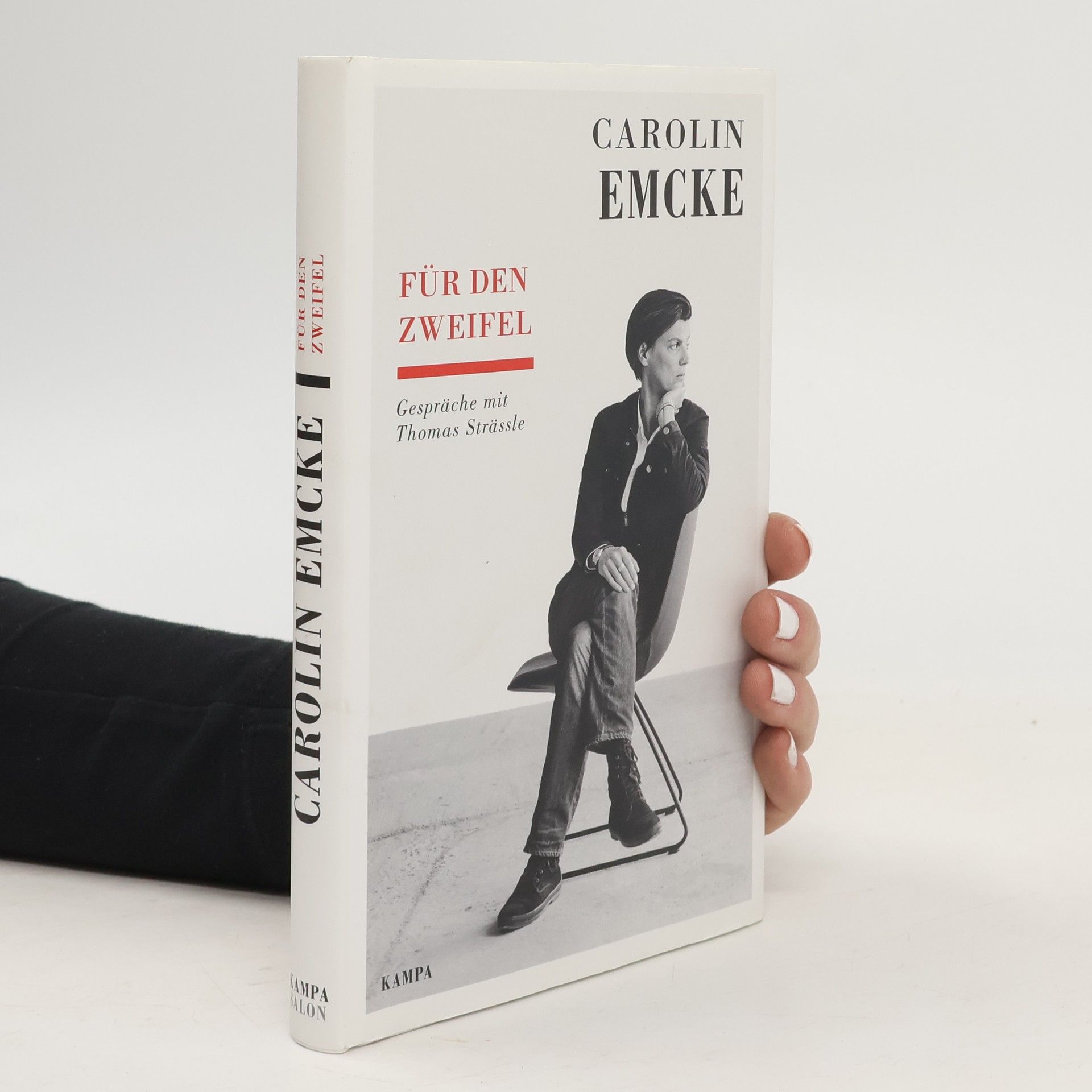




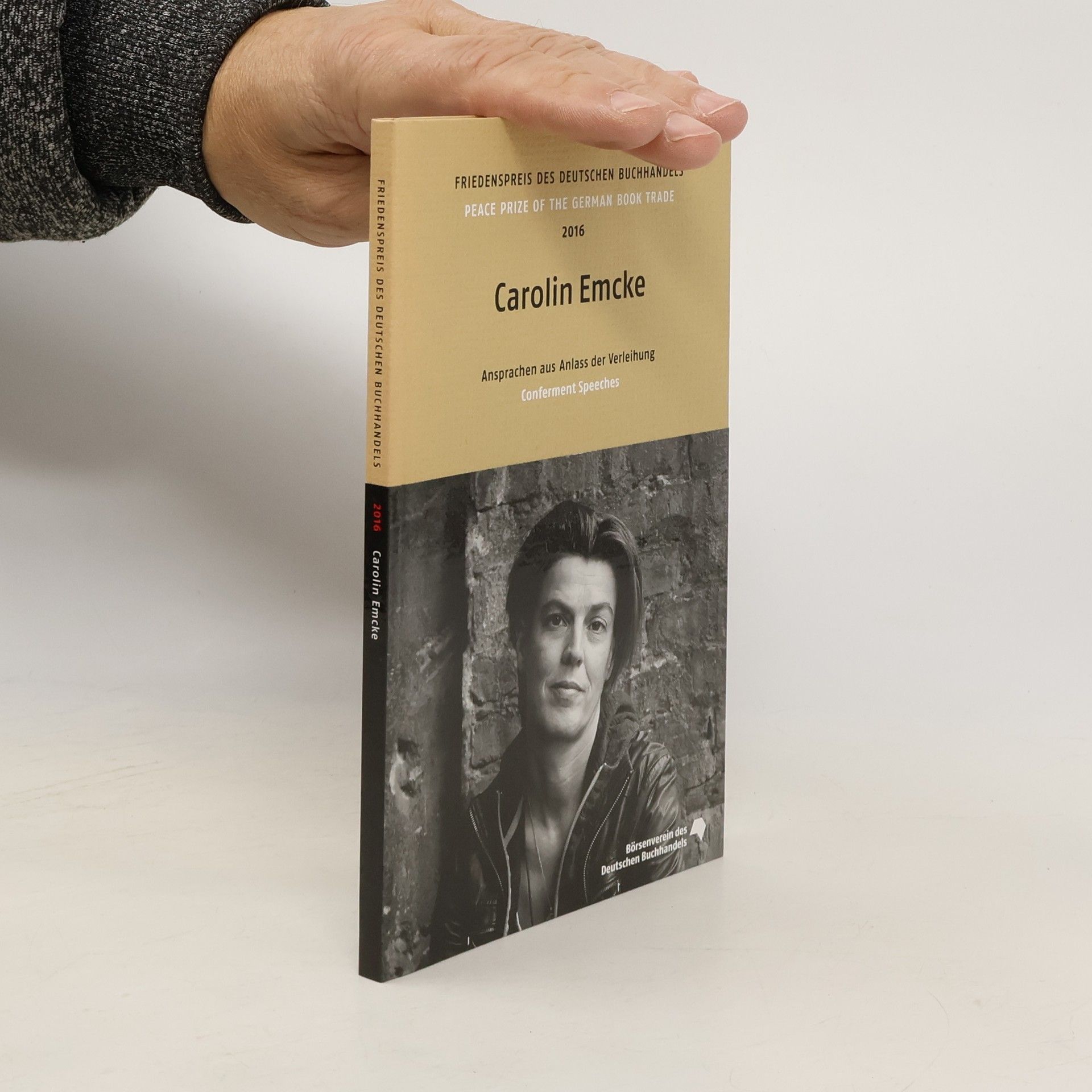
Bestseller-Autorin Carolin Emcke im Gespräch mit dem Literaturwissenschaftler Thomas Strässle – persönlich, politisch und aktuell Carolin Emcke erzählt von ihrem Werk und Leben. Sie spricht über ihre Zeit als Reporterin in internationalen Krisengebieten, berichtet vom Umgang mit Gewalt und ihrer Rolle als Zeugin. Aus Sicht der Philosophin fragt sie, wie wir Fanatismus und Hass in einer offenen Gesellschaft begegnen können. Im Zentrum ihres Denkens steht dabei stets die Achtung vor dem Anderen. Was bedeutet es, wenn Menschen ihren Glauben oder ihr Begehren nicht leben können? Dabei erzählt Carolin Emcke auch Persönliches: über prägende Texte oder ihre Liebe zu klassischer Musik.
Vielfältig sind die Themen, denen sich Carolin Emcke widmet, und vielfältig sind ihre Perspektiven. Und so adressieren auch die Gespräche mit dem Literaturwissenschaftler Thomas Strässle die unterschiedlichsten Aspekte von Carolin Emckes Werk und Leben. Als Reporterin in Krisengebieten hat sie den Umgang mit Gewalt betrachtet und ihre eigene Rolle als Zeugin fremden Leids und die der Medien reflektiert. Als Philosophin fragt sie, wie wir Hass und Fanatismus begegnen können in einer offenen Gesellschaft – und welche Rolle dabei eine fragmentierte Öffentlichkeit spielt, in der Desinformation und Lüge ungefiltert zirkulieren. Die Achtung vor dem Anderen steht dabei immer im Zentrum ihres Denkens. Was heißt es, wenn Menschen ihren Glauben oder ihr Begehren nicht zeigen, nicht artikulieren, nicht leben können? Welche Praktiken und Normen schließen aus oder ein? Bei alldem lässt Emcke sich selbst nicht außen vor: So erzählt sie auch von der Geschichte ihres eigenen Begehrens, davon, welche Texte sie geprägt haben, und von ihrer Liebe zur klassischen Musik.
Journal
Tagebuch in Zeiten der Pandemie
Bestseller-Autorin und Friedenspreis-Trägerin Carolin Emcke denkt in diesem persönlich-politischen Journal über das Ausnahme-Jahr 2020 nach. Am 22. März 2020 beschließen Bund und Länder »Kontaktbeschränkungen« – die neue Wirklichkeit der Pandemie greift ein in unsere psychische, soziale, politische Verfassung. Am Tag darauf beginnt Carolin Emcke mit ihrem »Journal«. Sie notiert nächtliche Albträume oder die unmöglichen Abschiede von geliebten Menschen so wie sie die nationalistischen Reflexe Europas und die autoritäre Verführung des Virus analysiert. Es sind subjektive, philosophische Notizen, die dieser historischen Zäsur nachspüren. Immer wieder widersetzt sich Carolin Emcke der Neigung, nur die eigene Stadt oder Region zu betrachten, immer wieder weitet sie den Fokus, reflektiert die Pandemie als globale Konstellation. Es ist die schonungs- und schutzlose Chronik eines Ausnahmezustands, von dem niemand weiß, wann er zu Ende sein und wie er uns verändert haben wird.
When I Say Yes
- 120pages
- 5 heures de lecture
Why the #MeToo movement has raised fundamental questions about sexuality and power that must be confronted by us all--
Carolin Emcke
Friedenspreis des deutschen Buchhandels 2016. Ansprachen aus Anlass der Verleihung
- 93pages
- 4 heures de lecture
Gegen den Hass
- 240pages
- 9 heures de lecture
»Es gilt zu mobilisieren, was dem Hassenden abgeht: die Fähigkeit zur Ironie, zu Zweifeln und die Vision einer offenen Gesellschaft.« Carolin Emcke Carolin Emcke, eine der wichtigsten Intellektuellen der Gegenwart, äußert sich in ihrem engagierten Essay »Gegen den Hass« zu den großen Themen unserer Zeit: Rassismus, Fanatismus, Demokratiefeindlichkeit. In der zunehmend polarisierten, fragmentierten Öffentlichkeit dominiert vor allem jenes Denken, das Zweifel nur an den Positionen der anderen, aber nicht an den eigenen zulässt. Diesem dogmatischen Denken, das keine Schattierungen berücksichtigt, setzt Carolin Emcke ein Lob des Vielstimmigen, des »Unreinen« entgegen — weil so die Freiheit des Individuellen und auch Abweichenden zu schützen ist. Allein mit dem Mut, dem Hass zu widersprechen, und der Lust, die Pluralität auszuhalten und zu verhandeln, lässt sich Demokratie verwirklichen. Nur so können wir den religiösen und nationalistischen Fanatikern erfolgreich begegnen, weil Differenzierung und Genauigkeit das sind, was sie am meisten ablehnen. Für alle, die überzeugende Argumente und Denkanstöße suchen, um eine humanistische Haltung und eine offene Gesellschaft zu verteidigen.
Weil es sagbar ist
Über Zeugenschaft und Gerechtigkeit
***Die vielfach ausgezeichneten Texte der renommierten Journalistin und Intellektuellen Carolin Emcke*** Wie lässt sich von Krieg und Gewalt erzählen? Gibt es dabei Grenzen des Verstehens? Schwellen des Sagbaren? Welche Bedingungen muss eine gerechte Gesellschaft schaffen, damit die Opfer von Gewalt über das Erlittene sprechen können? Diesen Fragen stellt sich Carolin Emcke mit ihren Essays in der Überzeugung, dass es nicht nur möglich, sondern nötig ist, vom Leid anderer zu erzählen – für die Opfer von Gewalt ebenso wie für die Gemeinschaft, in der wir leben wollen. Sie argumentiert gegen das »Unbeschreibliche« und für das Ethos der Empathie und des Erzählens. Für ihre scharfsinnigen und empathischen Texte erhielt sie zuletzt den Merck-Preis 2014, den Otto-Brenner-Preis für kritischen Journalismus und die Auszeichnung »Journalistin des Jahres«.
+++ Die wichtigsten Vor- und Nachdenker unserer Zeit in einem Band +++§§In diesem Buch sind sie versammelt: einige der klügsten Köpfe der Gegenwart. Sie bieten uns ein Kaleidoskop an Ideen, Impulsen und Anregungen zum Nachdenken, die uns Hinweise und Antworten auf die wichtigsten Fragen unserer Zeit liefern.§§Mit Denkanstößen u.a. von ROGER WILLEMSEN über den Ernst des Lebens, CAROLIN EMCKE über latenten Rassismus in unserer Gesellschaft, NINA PAUER über Liebe und Angst im Leben einer Mittdreissigerin, HARALD WELZER über den Klimawandel - und warum dieser eine Chance ist, STEFAN KLEIN über das Glück und wie wir es finden können...§§Beiträge von Kai Biermann & Martin Haase, Carolin Emcke, Rainer Erlinger, Joachim Helfer, Gerald Hüther, Stefan Klein, Nina Pauer, Robert Pfaller, Antje Rávic Strubel, Arnold Retzer, Hanne Tügel, Harald Welzer und Roger Willemsen.§
How We Desire
- 256pages
- 9 heures de lecture
• A genre-busting, thoughtful and highly readable exploration of sexuality and identity by one of Germany’s most admired writers • In this extended personal essay, Emcke draws on her own experiences to guide readers to consider how we desire, and how that affects what it means to be a person • Emcke turns her incisive reporter’s eye to her own experiences of desire and coming of age, weaving a story that is filled with evocative anecdotes and astute observations about identity, sexuality and love • Just as How We Desire attempts to resist the cultural categories and limitations put upon human desire, this broad and nuanced essay defies typical genre categories • Emcke worked as a war correspondent for Der Spiegel for fifteen years. She reported from war and crisis zones including the Gaza Strip, Afghanistan, Pakistan and Iraq • Emcke’s reportage is critically acclaimed in Germany, where she has previously published a number of books. In 2016 she received the German Book Trade’s Peace Prize, an award previously won by Svetlana Alexievich, Susan Sontag and Margaret Atwood • How We Desire is the first of Emcke’s books to be translated into English • Will appeal to fans of Maggie Nelson’s The Argonauts, Emily Witt’s Future Sex, Eula Biss’ On Immunity, and Rebecca Solnit’s Men Explain Things To Me