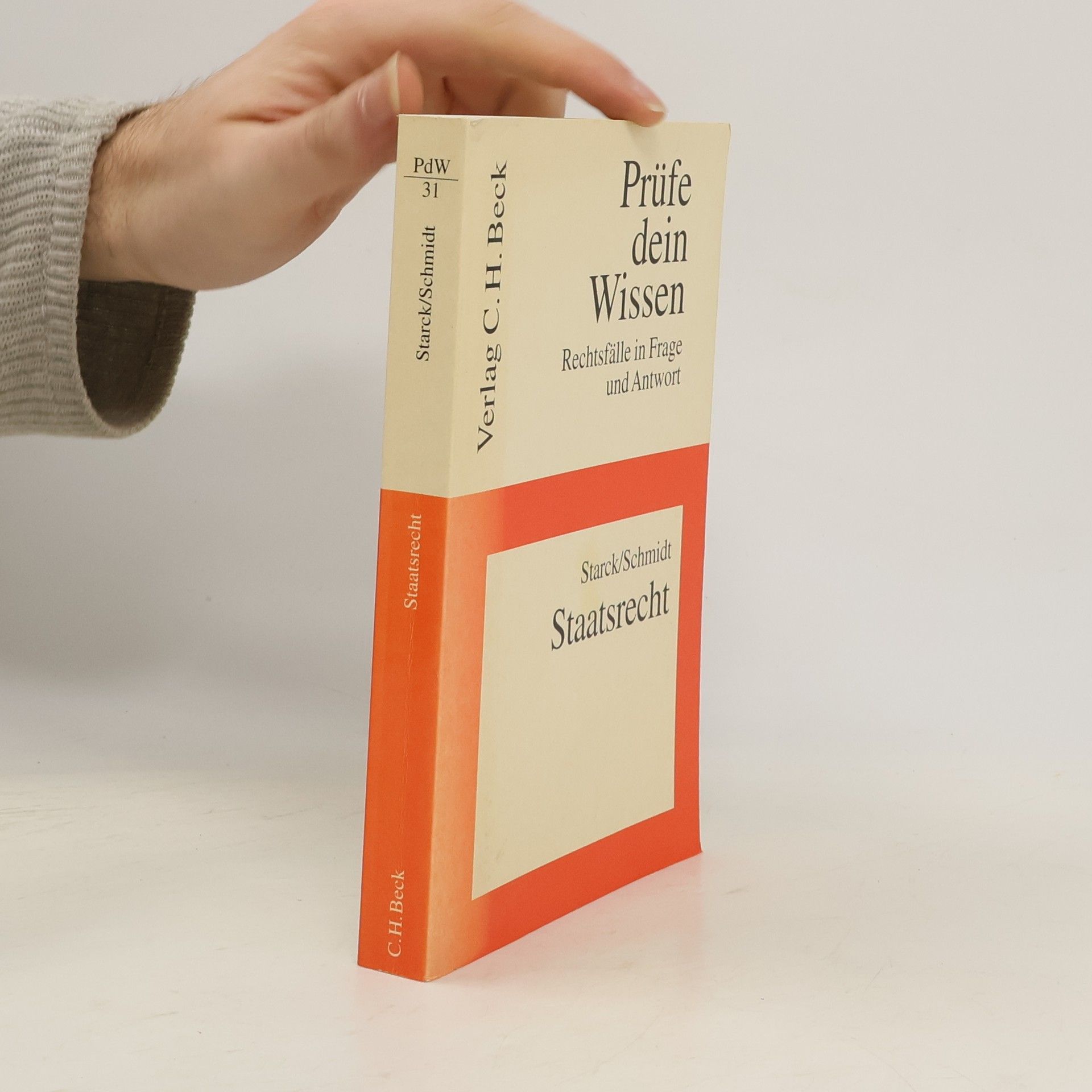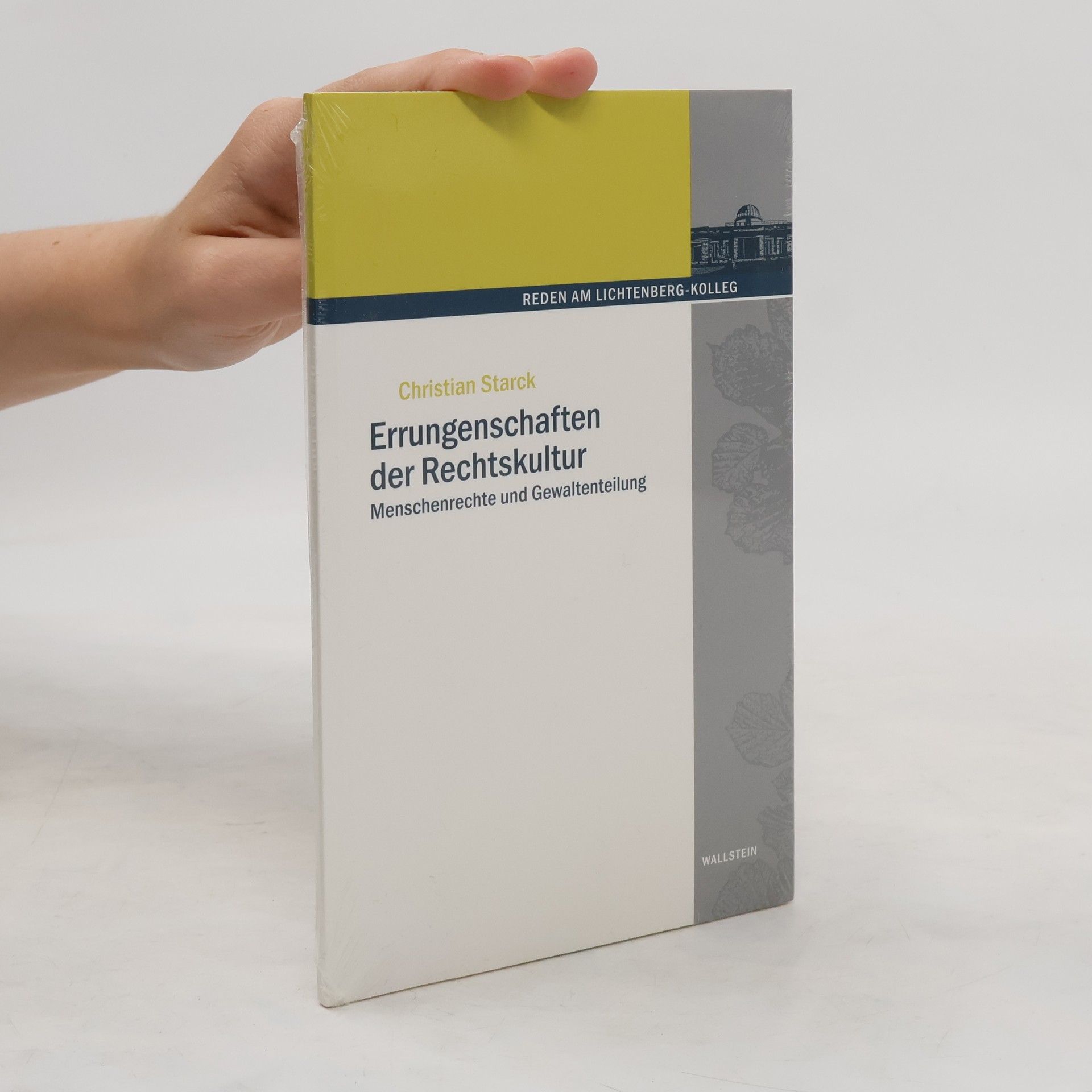Errungenschaften der Rechtskultur
- 40pages
- 2 heures de lecture
Unter Rechtskultur wird die entwickelte und gepflegte Organisation menschlichen Zusammenlebens verstanden – Rechtskultur hängt von der politischen Kultur einer Gesellschaft ab und prägt diese zugleich. In seiner Untersuchung spürt Christian Starck den Wurzeln der Errungenschaften unserer Rechtskultur nach. Als deren Grundlagen werden die Menschenrechte und die Gewaltenteilung ausgemacht, die beide der Mäßigung der Staatsgewalt dienen und Räume individueller Freiheit sichern. Während diese Grundlagen gemeinhin neuzeitlich verortet und mit der französischen Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte bestimmt werden, zeigt Starck in historischer Perspektive deren Fundamente in der Antike und im biblisch-christlichen Menschenbild auf, weist aber auch Unterschiede und wechselseitige Rezeptionen verschiedener Rechtskulturen nach. In diesem Kontext diskutiert der Autor historische Entgleisungen, die Rechtsperversionen des 20. Jahrhunderts und schließt mit einem Blick auf aktuelle Gefährdungen der Errungenschaften der Rechtskultur.