Werke / Radierungen / Kupferstiche / Federzeichnungen, Zeichnungen.
Ute Schneider Livres
November 9, 1960
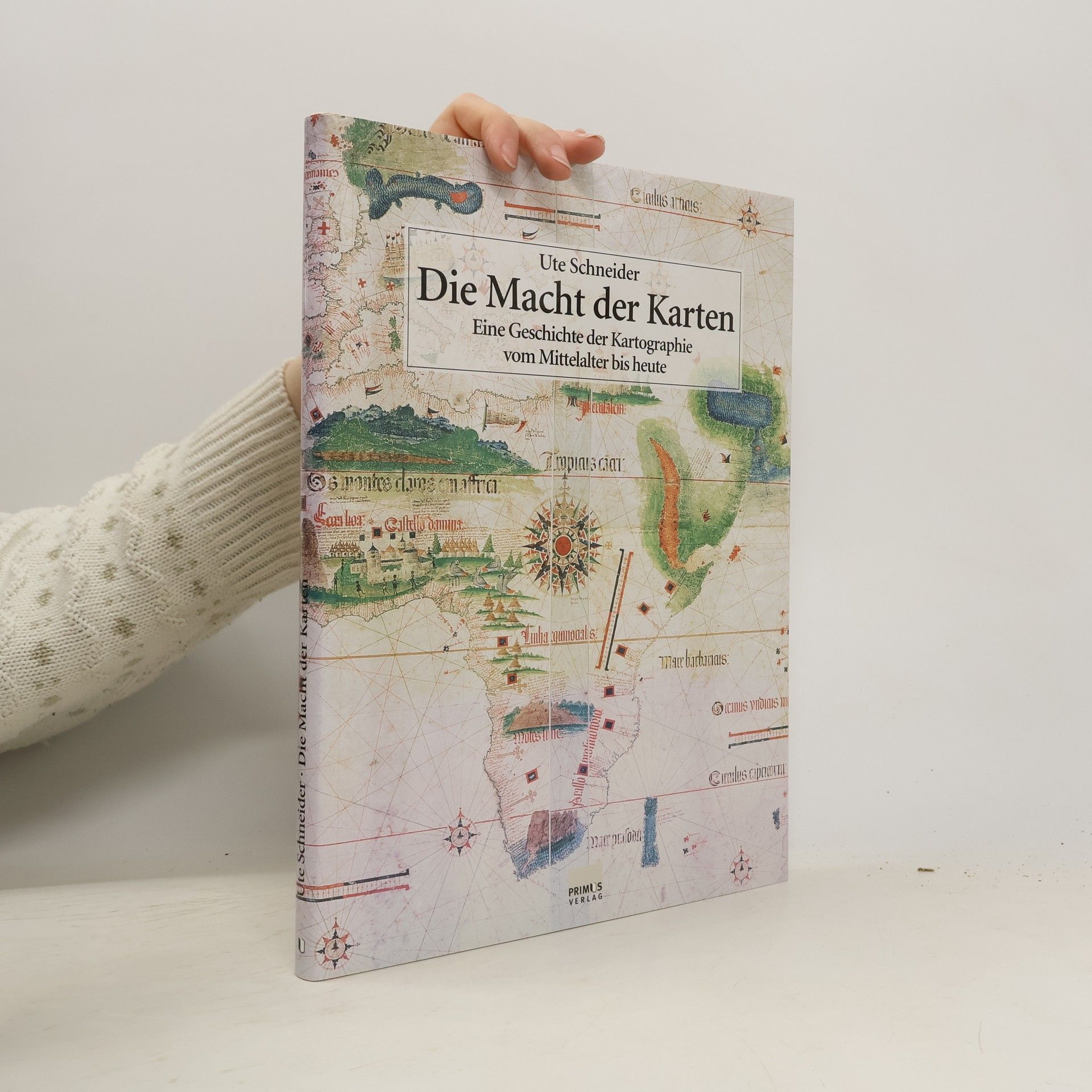

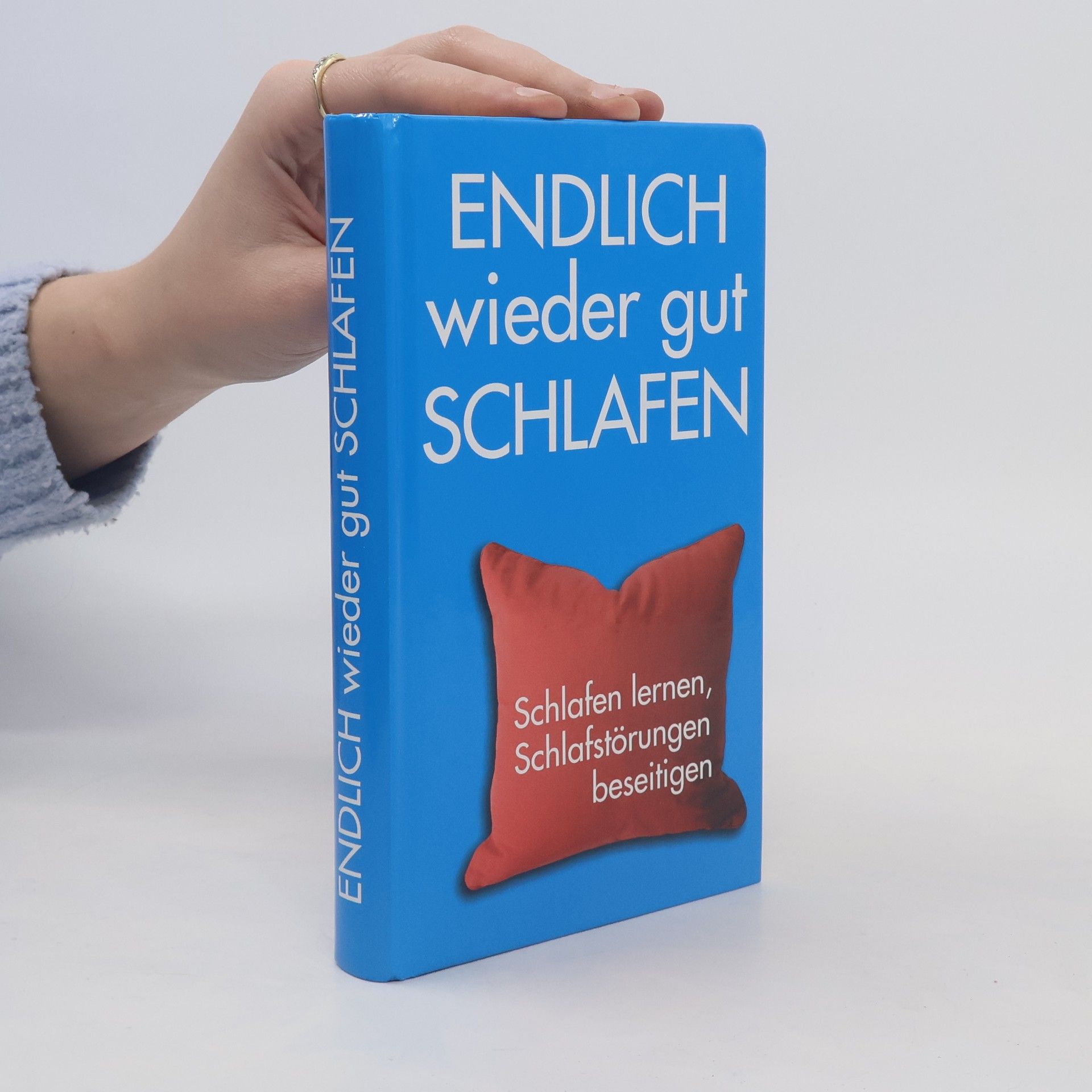
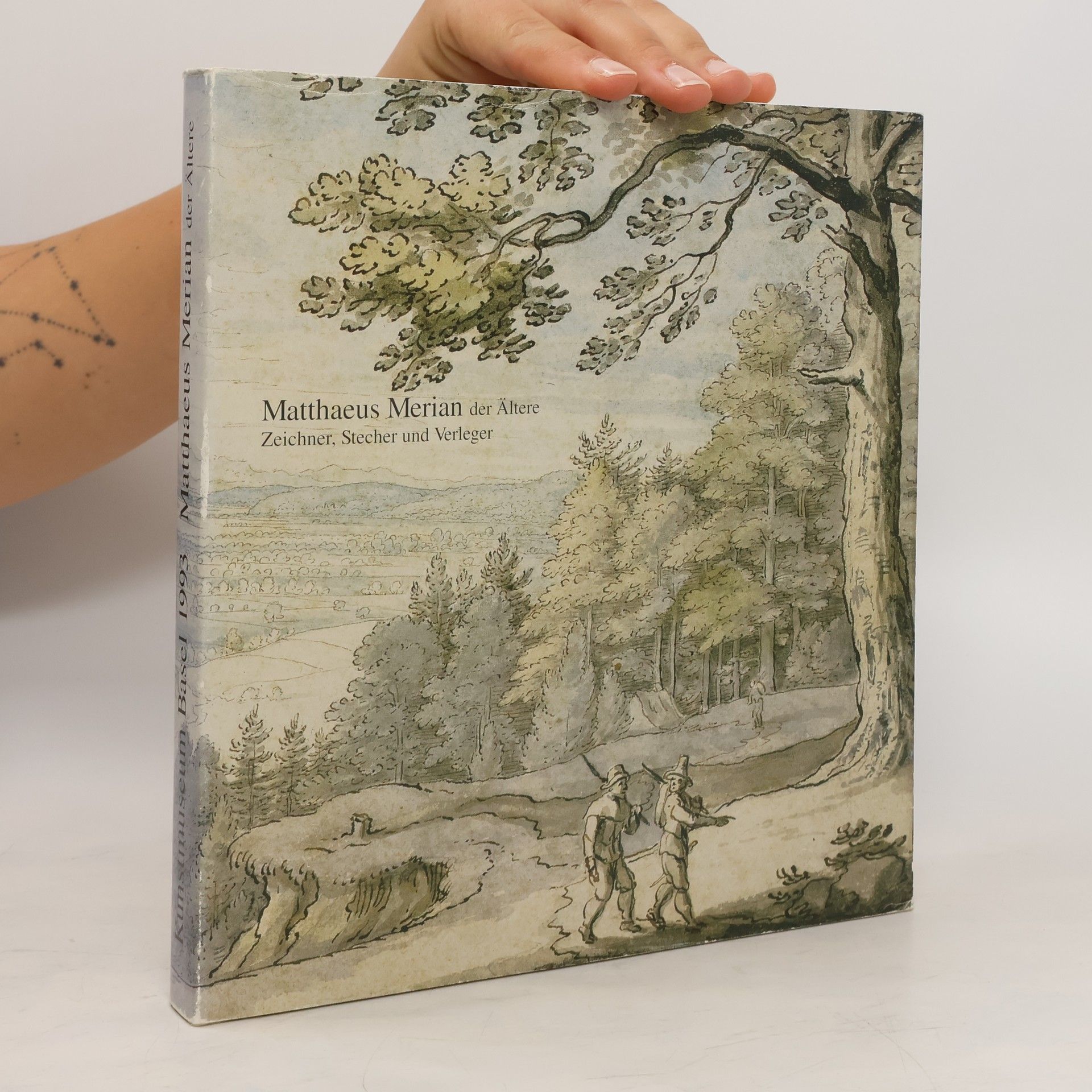
Die Macht der Karten
Eine Geschichte der Kartographie vom Mittelalter bis heute
- 144pages
- 6 heures de lecture
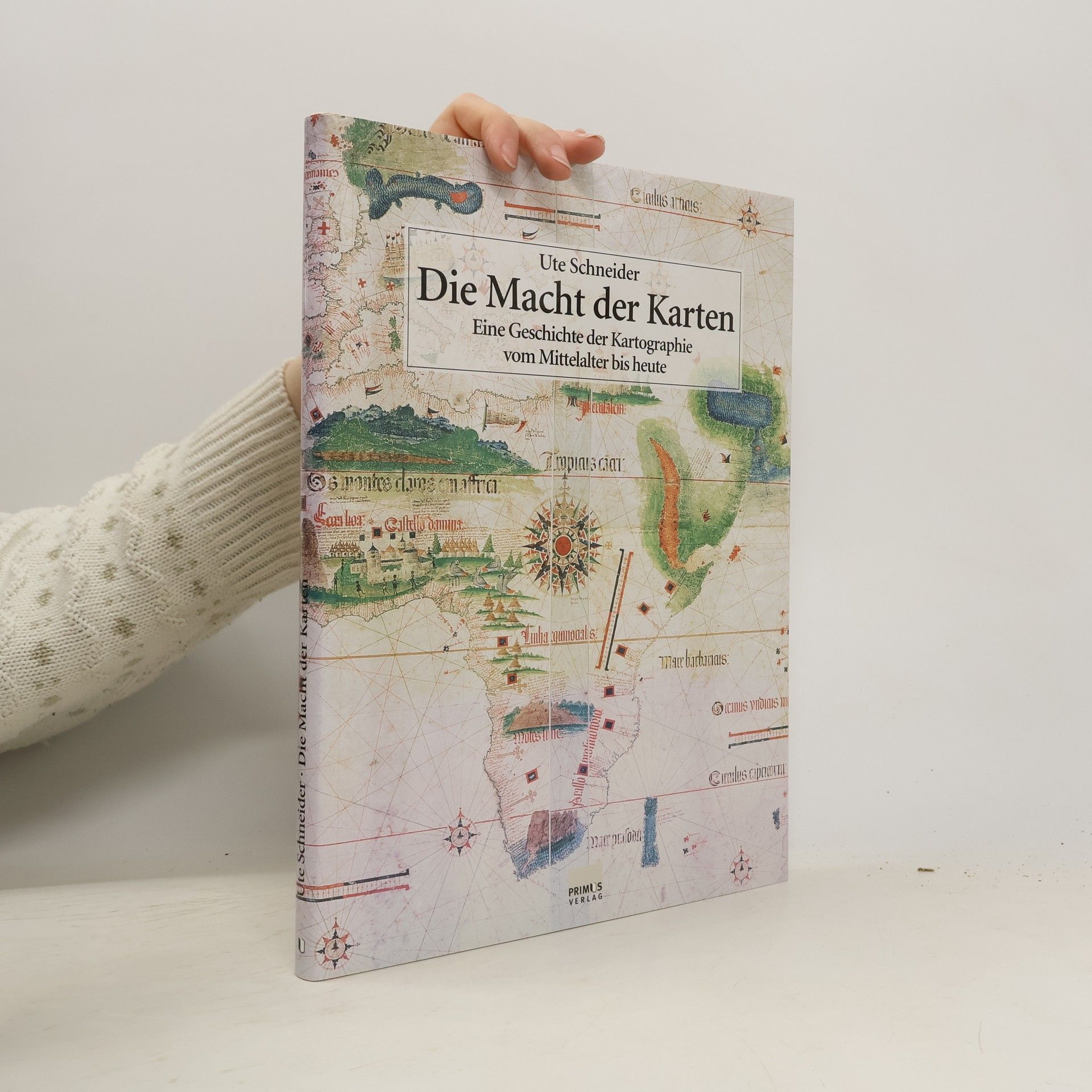

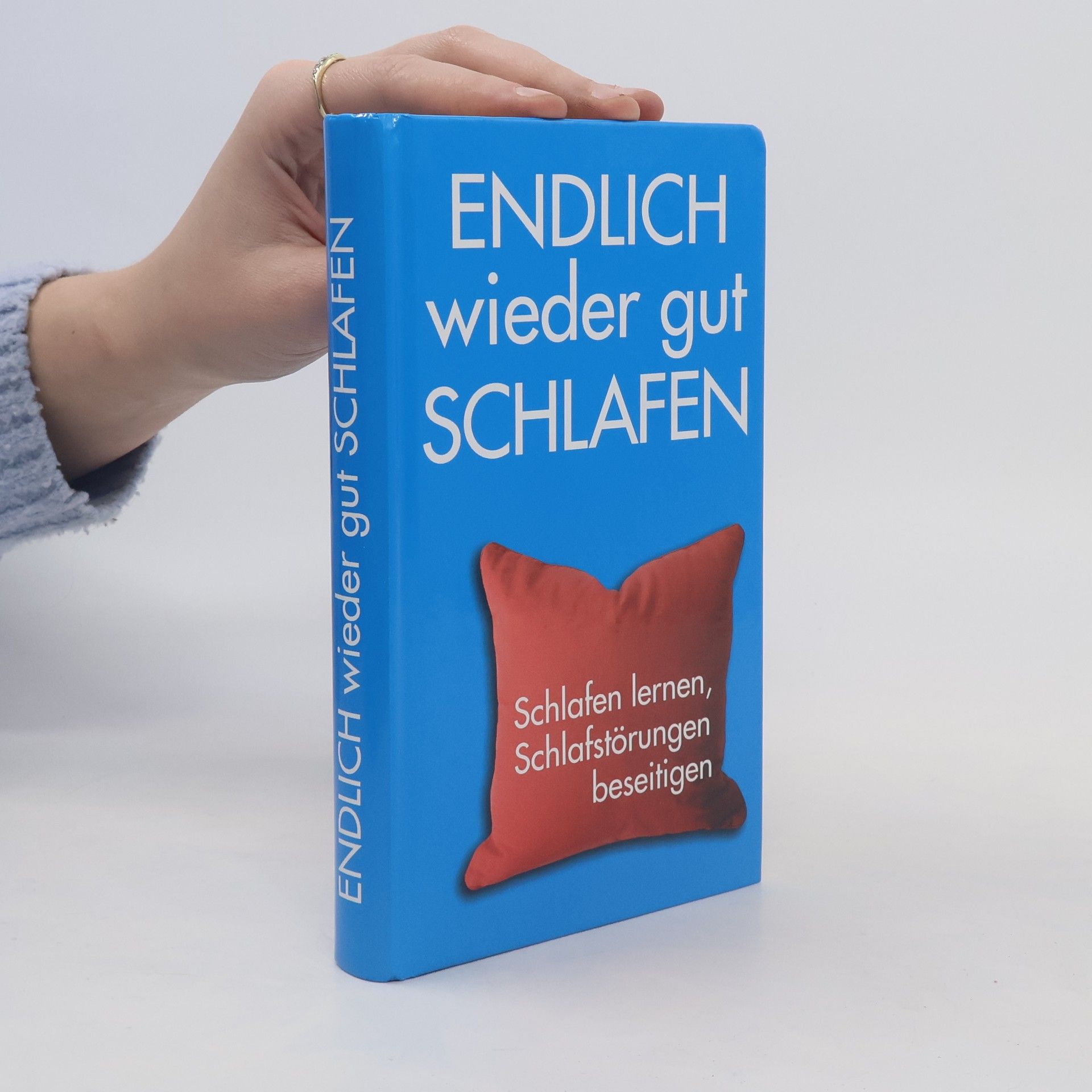
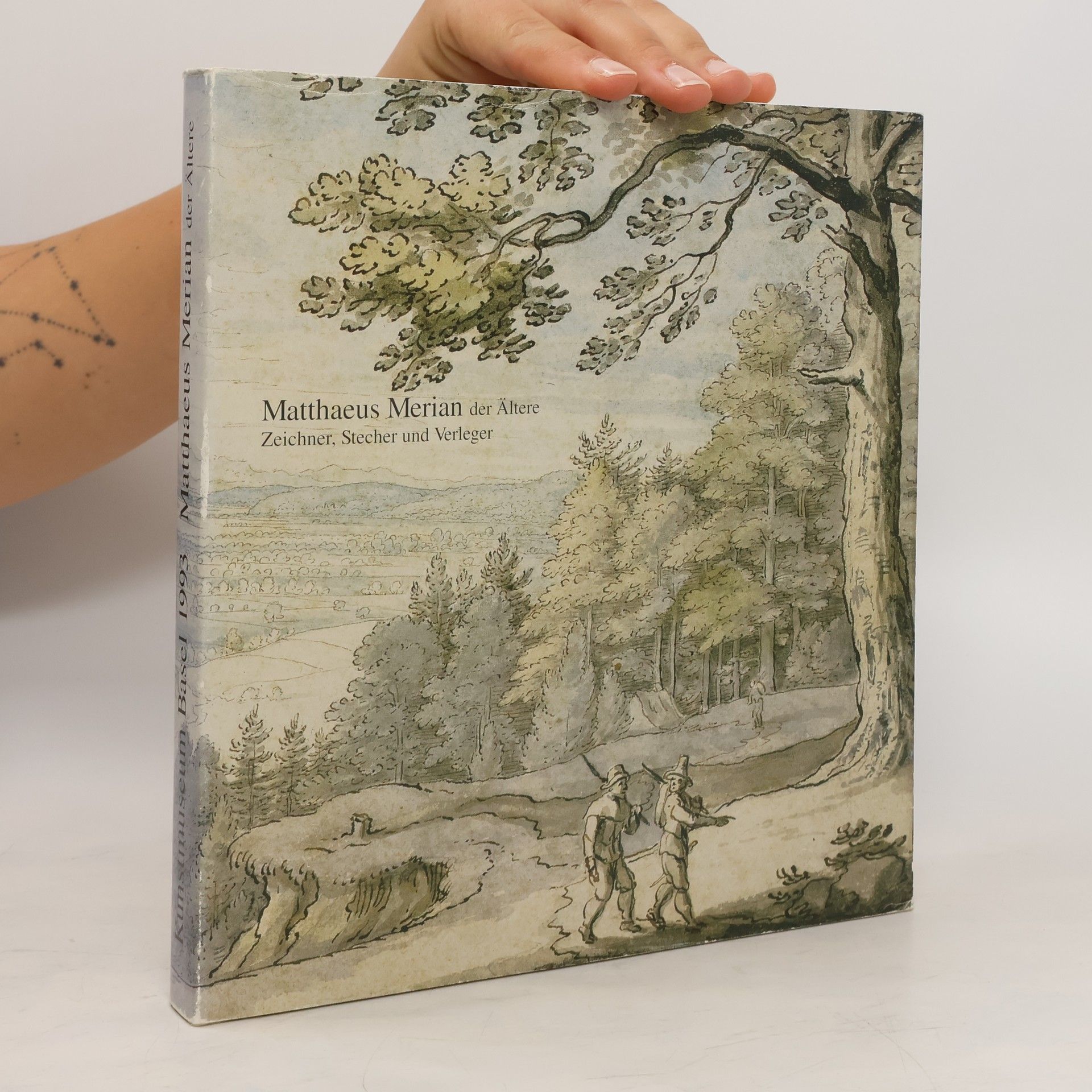
Werke / Radierungen / Kupferstiche / Federzeichnungen, Zeichnungen.
Eine Geschichte der Kartographie vom Mittelalter bis heute