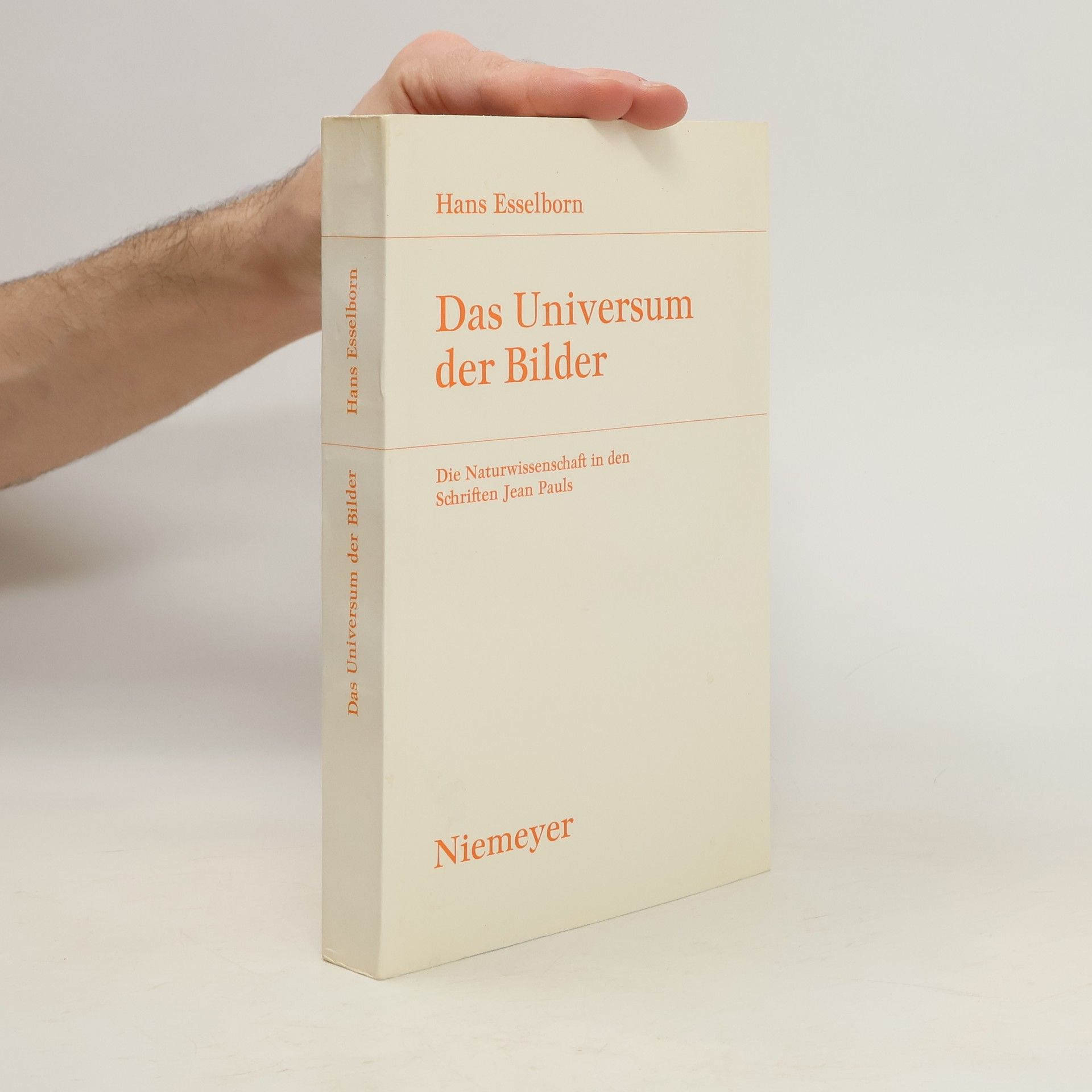Das Science Fiction Jahr 2024
- 600pages
- 21 heures de lecture
Die 39. Ausgabe von DAS SCIENCE FICTION JAHR untersucht die Rolle der künstlichen Intelligenz in der Science Fiction und deren Einfluss auf unseren Alltag, insbesondere auf kreative Berufe. Renommierte Autor:innen wie Judith und Christian Vogt sowie Uwe Neuhold, Lena Richter und Simon Spiegel bieten vielseitige Perspektiven und Analysen, die die Verbindung zwischen technologischem Fortschritt und künstlerischem Schaffen beleuchten. Die Beiträge regen zur Reflexion über die Zukunft von KI und deren Auswirkungen auf die Gesellschaft an.