Zwischen Kindheit und Kultur
Grundzüge einer Theorie der Grundschule
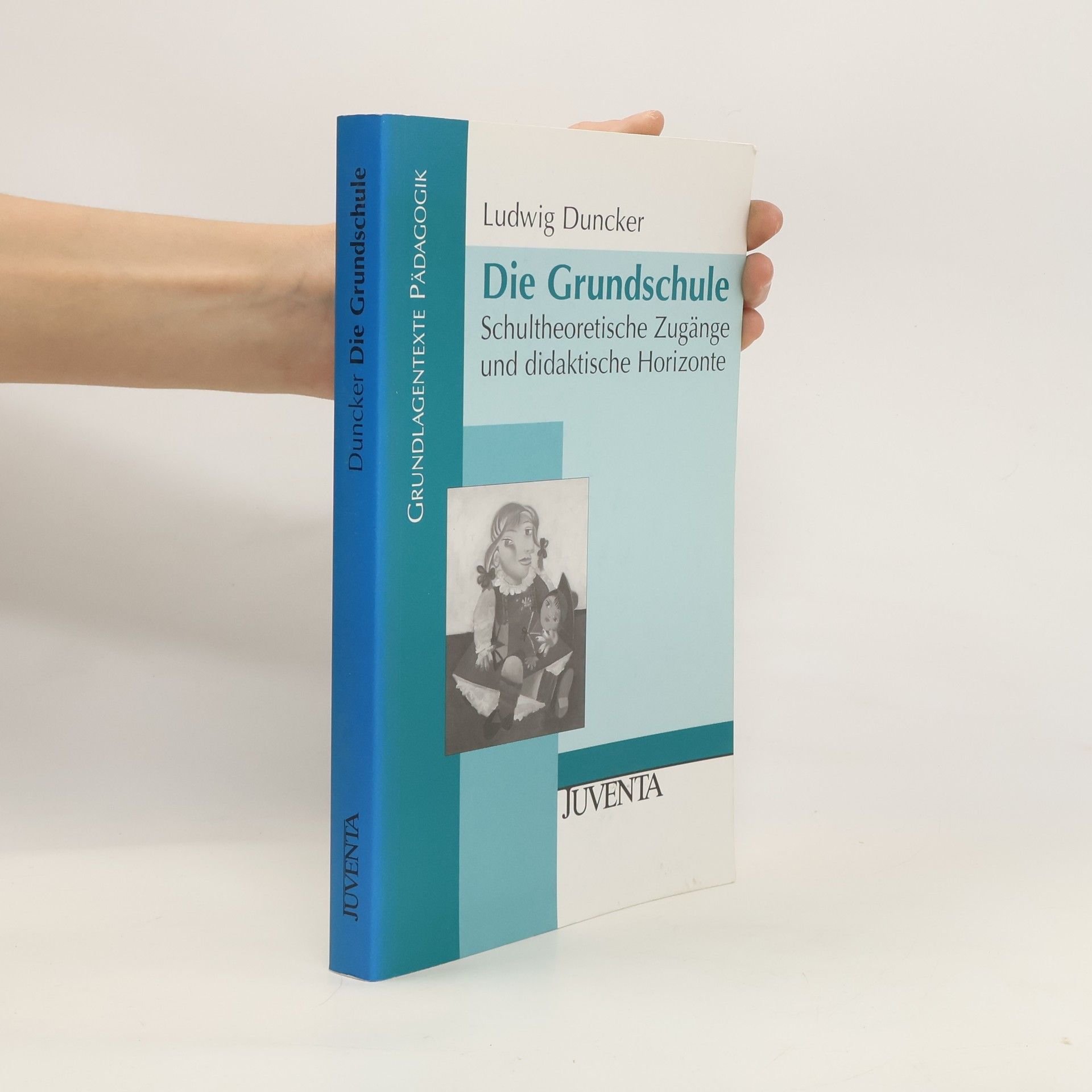

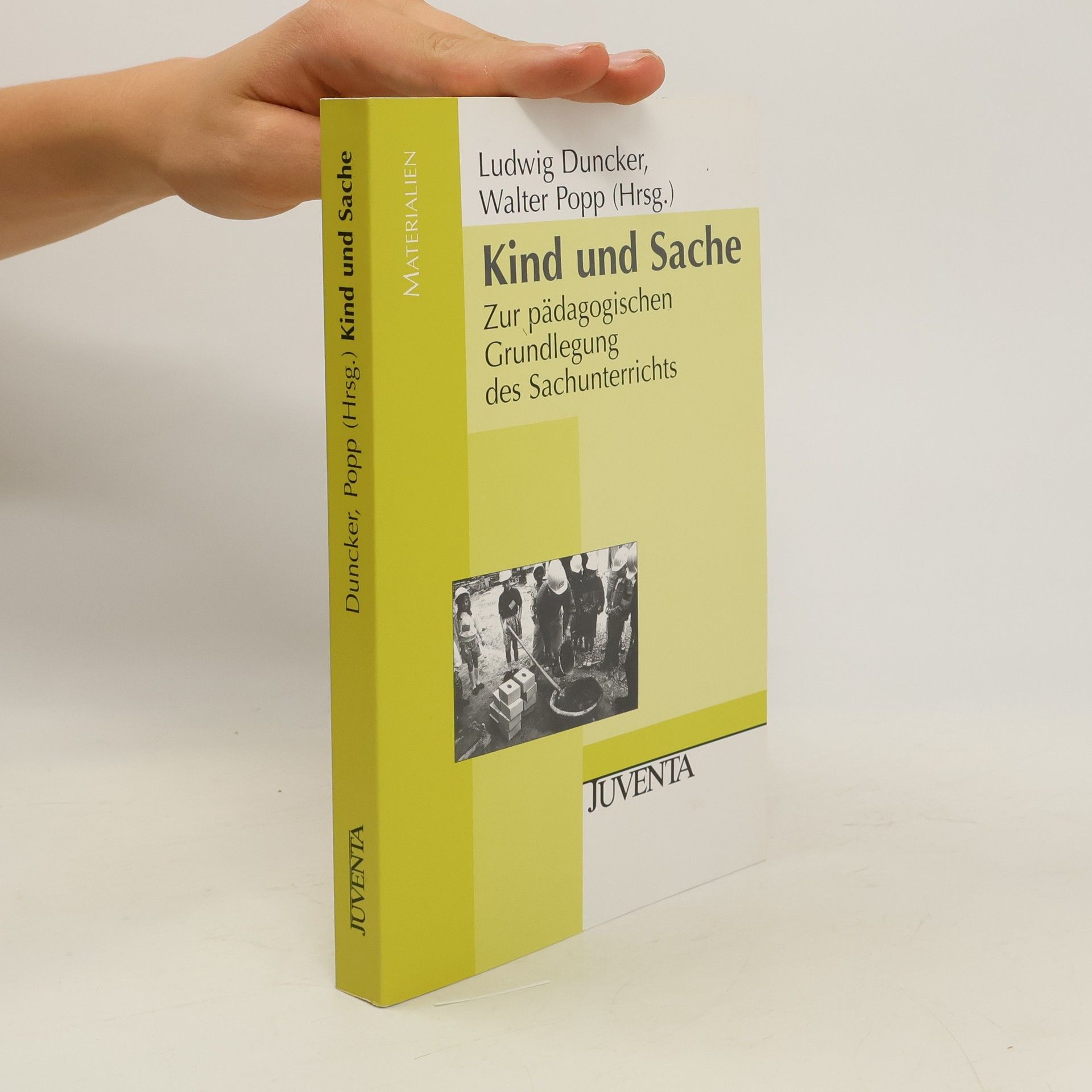


Grundzüge einer Theorie der Grundschule
Zum Bildungsanspruch des Lehrens und Lernens
So lernen Kinder Verschiedene internationale Vergleichsstudien haben gezeigt, dass die frühkindliche Bildung verstärkte Beachtung und Förderung verdient. Leider mangelt es trotz guter Ansätze noch an den Strukturen in Ausbildung und Praxis, um für Kinder gute Voraussetzungen auch für die spätere schulische Laufbahn zu schaffen. Verschaffen Sie sich mit diesem Handbuch einen Überblick über den aktuellen Stand der Diskussion. Im Vordergrund steht die Frage nach dem Verständnis von Kindheit und kindlichem Lernen. Dabei legen die Autoren ein Bildungsverständnis zugrunde, das vom Kind ausgeht und Kinder als Akteure ihrer Entwicklung versteht. Sie spüren den kindlichen Interessen und Vorlieben nach und interpretieren diese in Hinblick auf das oft selbstgeleitete Lernen der Kinder. Geeignet für Studierende, Elementarpädagoginnen und Grundschullehrkräfte.
Der Band greift einige Traditionslinien grundschulpädagogischen Denkens auf und interpretiert diese neu. Damit leistet er einen Beitrag zur Vertiefung und Weiterführung der grundschulpädagogischen Diskussion.
SCHLAGWÖRTERS: AnthropologischS. PhilosophierenS. VerfremdenS. InterkulturellS. WagenscheinS. ProblemorientiertS. UmweltverstehenS. MedienpädagogikS. MediendidaktikS