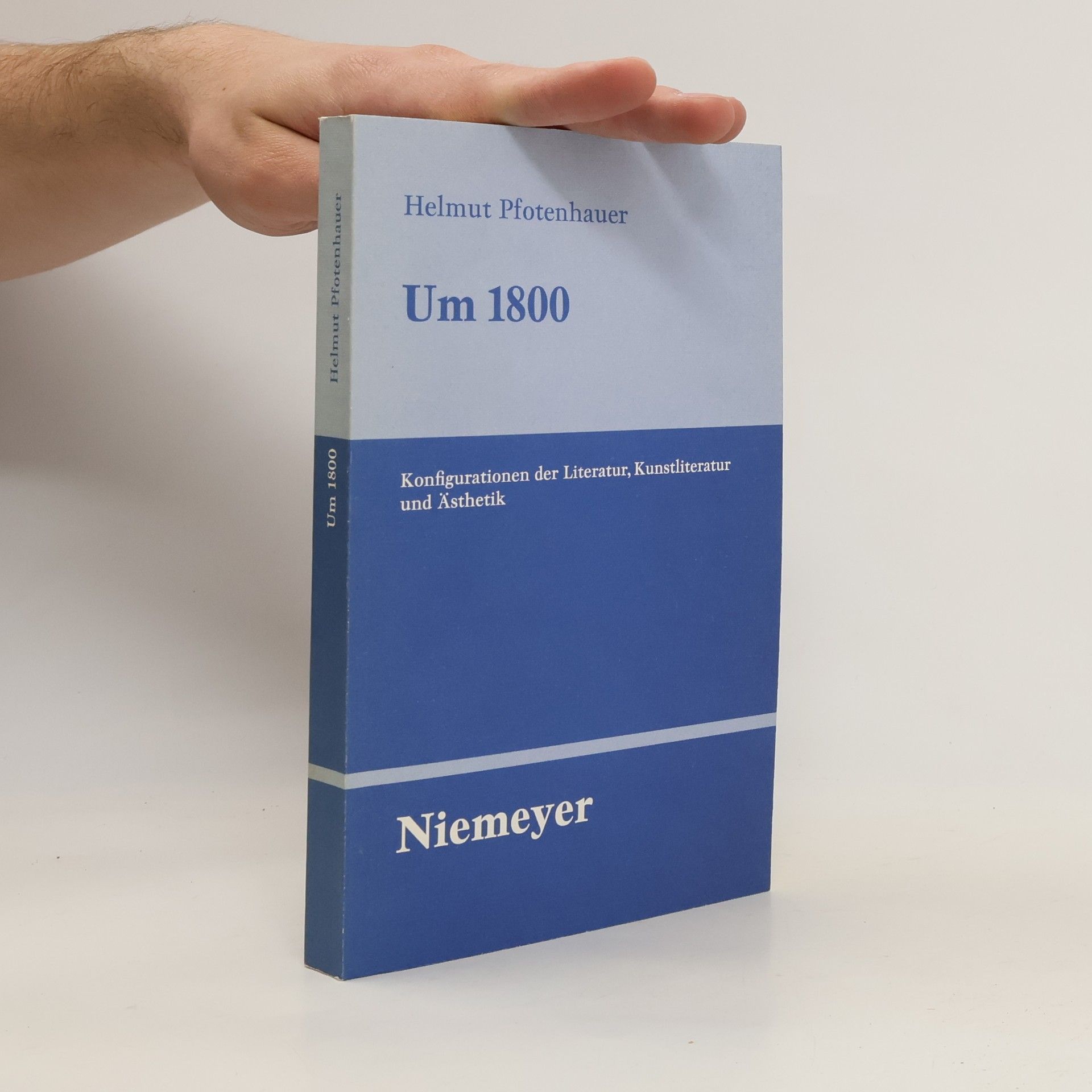Der Streit um Klassizität
Polemische Konstellationen vom 18. zum 21. Jahrhundert
- 332pages
- 12 heures de lecture
Blick ins BuchDer Band versucht, das Verhältnis von Klassizismus und Antiklassizismus als polemische Konstellation zu fassen.Die einzelnen Beiträge nehmen die Beziehungen zwischen Klassizismus und Antiklassizismus vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart in den Blick. Gefragt wird nach den polemischen Konstellationen, in denen literarische wie künstlerische Werke beider Strömungen sich aufeinander beziehen, sich gegeneinander abgrenzen und so profilieren. Kontroversen dieser Art lassen sich häufig nicht auf die Intentionen einzelner Akteure zurückführen, sondern werden nur aus einer genaueren Autopsie der strukturellen Verschiebungen erklärbar, die die konkurrierenden Einsätze ermöglichen und deren Ausdruck sie sind. Eine solche Sichtweise soll die wechselseitige Erzeugung und Profilierung distinkter ästhetischer Positionen durch Konkurrenzverhältnisse neu modellieren.