Helga Gotschlich Livres

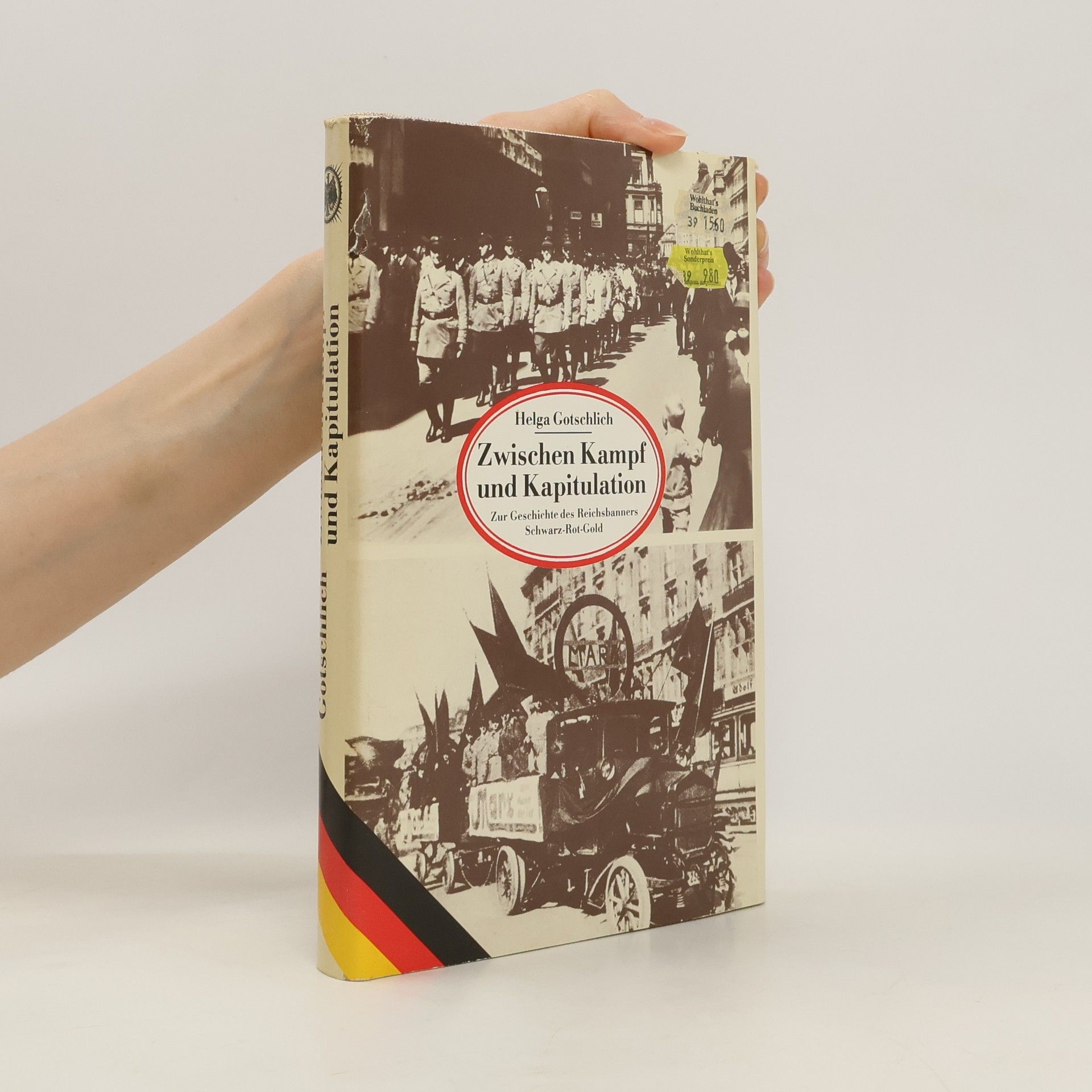

„Um eure Perspektive ist mir nicht bange!“ Diese Abschiedsworte ihres Rektors begleiteten 1939 vierundfünfzig Abiturienten der Dresdner Dreikönigschule in den Zweiten Weltkrieg. Die Hälfte von ihnen kehrte nicht zurück.Was hatte eine willige Jugend gegen ihre eigenen Interessen in das Verderben getrieben? Dieser und weiteren Fragen stellen sich die Überlebenden, heute verstreut in beiden Teilen Deutschlands. Ihre Aussagen, von der Autorin kenntnisreich und sensibel in ein Gerüst historischer Fakten und Zusammenhänge eingefügt, ermöglichen eigenständige Betrachtungsweisen der Interviewpartner über Geist und Ungeist einer Zeit, die sie seit frühester Jugend bis ins Mannesalter prägte. Zu diesem Erlebnisbild zählen die Wandervogelromantik einer freien und bündischen Jugendbewegung, Erziehungskonzeptionen von Staat und Schule in der Weimarer Republik und im „Dritten Reich“, das Ausgerichtetsein in der „Hitlerjugend“ sowie Urteile und Vorurteile eines bürgerlichen Elternhauses. Die Belege sind vielfältig. Sie reichen vom Schulaufsatz, von enthüllenden Darlegungen über eine zunehmende Militarisierung des Alltags, nachdenklich stimmenden Frontbriefen bis hin zu ganz persönlichen Zeugnissen. Eindrucksvolle Bilddokumente vertiefen das Gesagte.