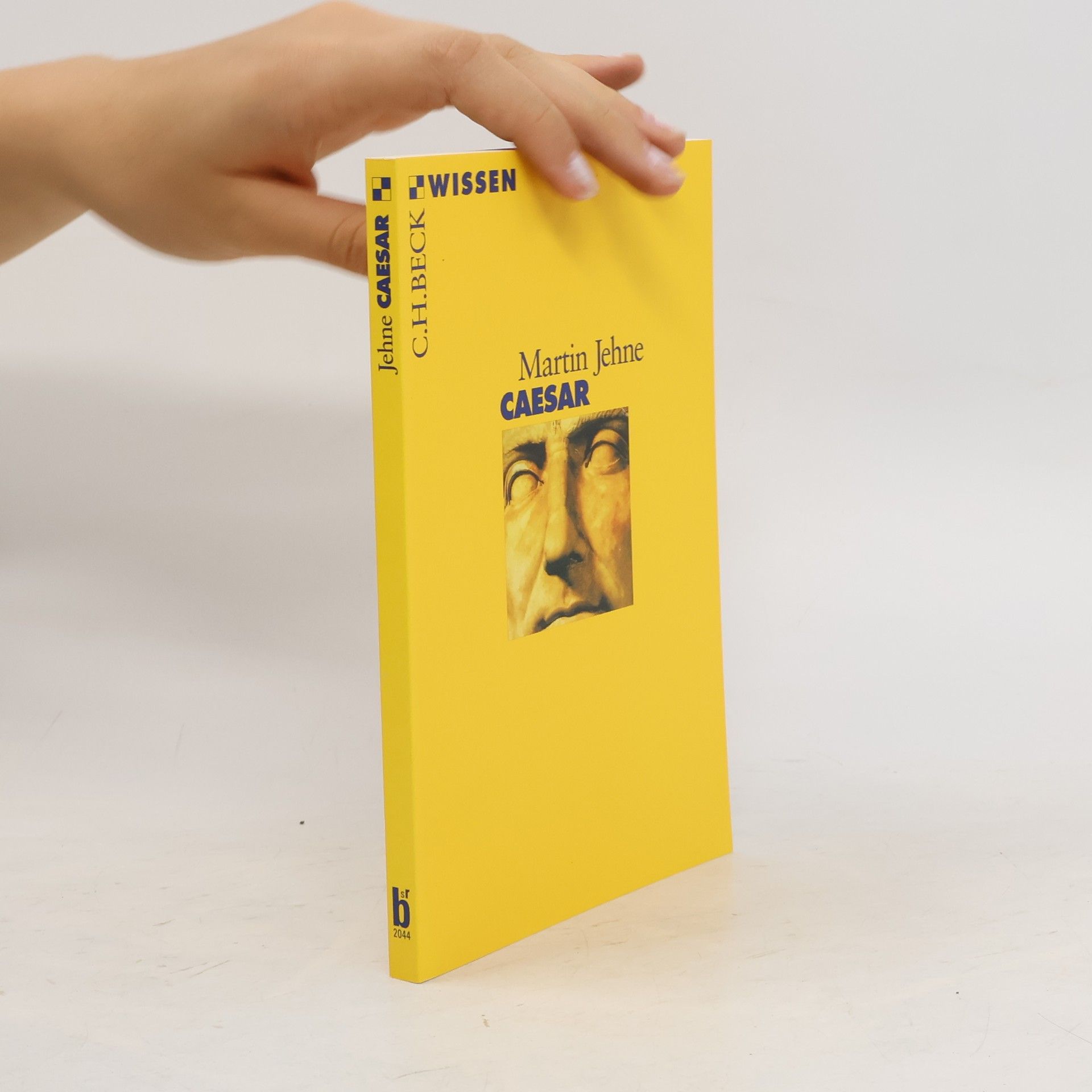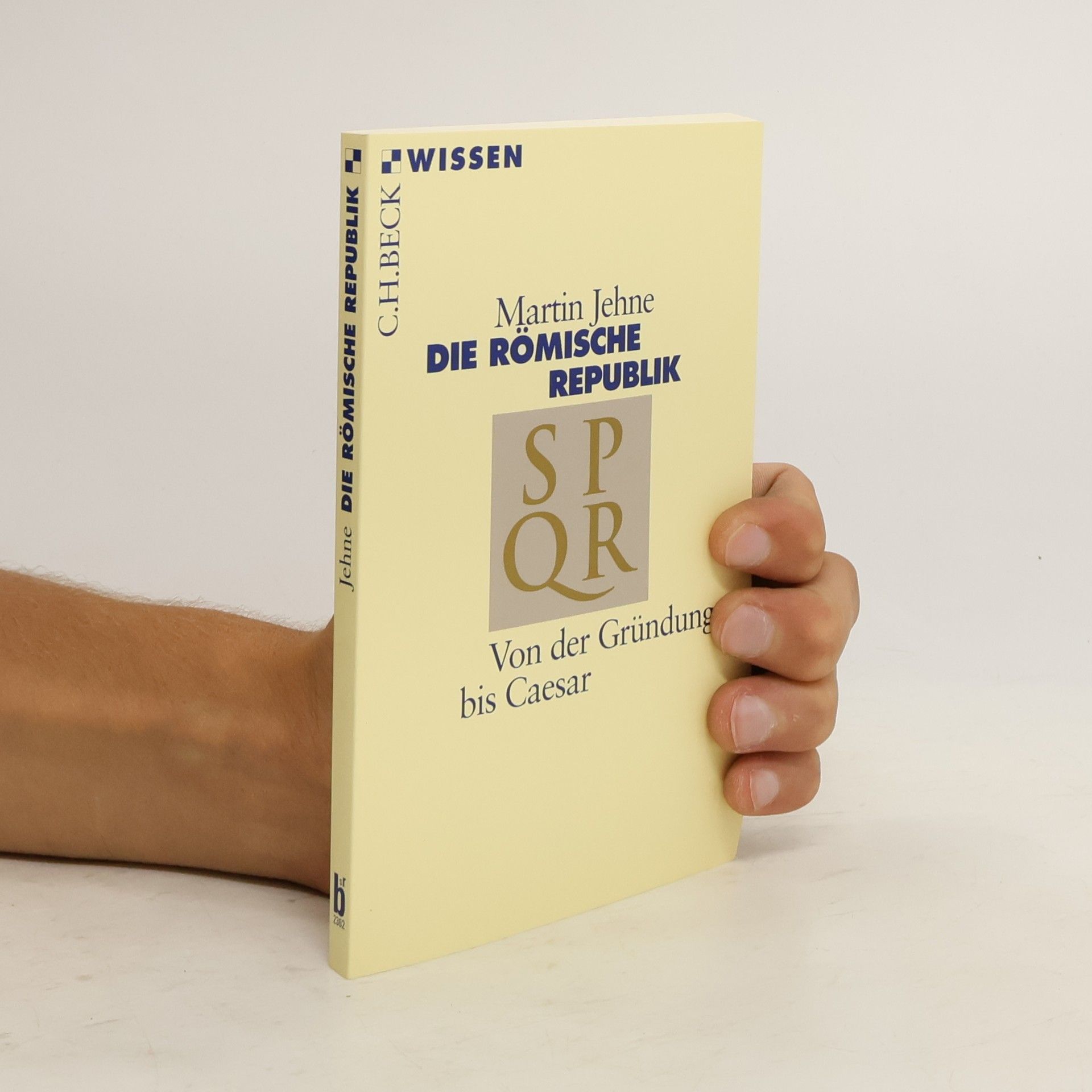Freud und Leid römischer Senatoren
Invektivarenen in Republik und Kaiserzeit
- 88pages
- 4 heures de lecture
Der Karl-Christ-Preis, der dem Andenken an den Marburger Althistoriker Karl Christ gewidmet (1923?2008) ist, wurde im Jahr 2019 an den Ordinarius für Alte Geschichte der TU Dresden Martin Jehne verliehen. Jehne genießt als vorzüglicher Kenner der Geschichte der römischen Republik national wie international höchstes Ansehen. Seine wissenschaftsgeschichtlich und theoretisch reflektierten Beiträge zur politischen Kultur im Altertum sind weit über die Grenzen seines Faches rezipiert worden. In seinem herausragenden Einsatz für den akademischen Nachwuchs weiß er sich dem Erbe Karl Christs verpflichtet