Wolfgang Kowalsky Livres
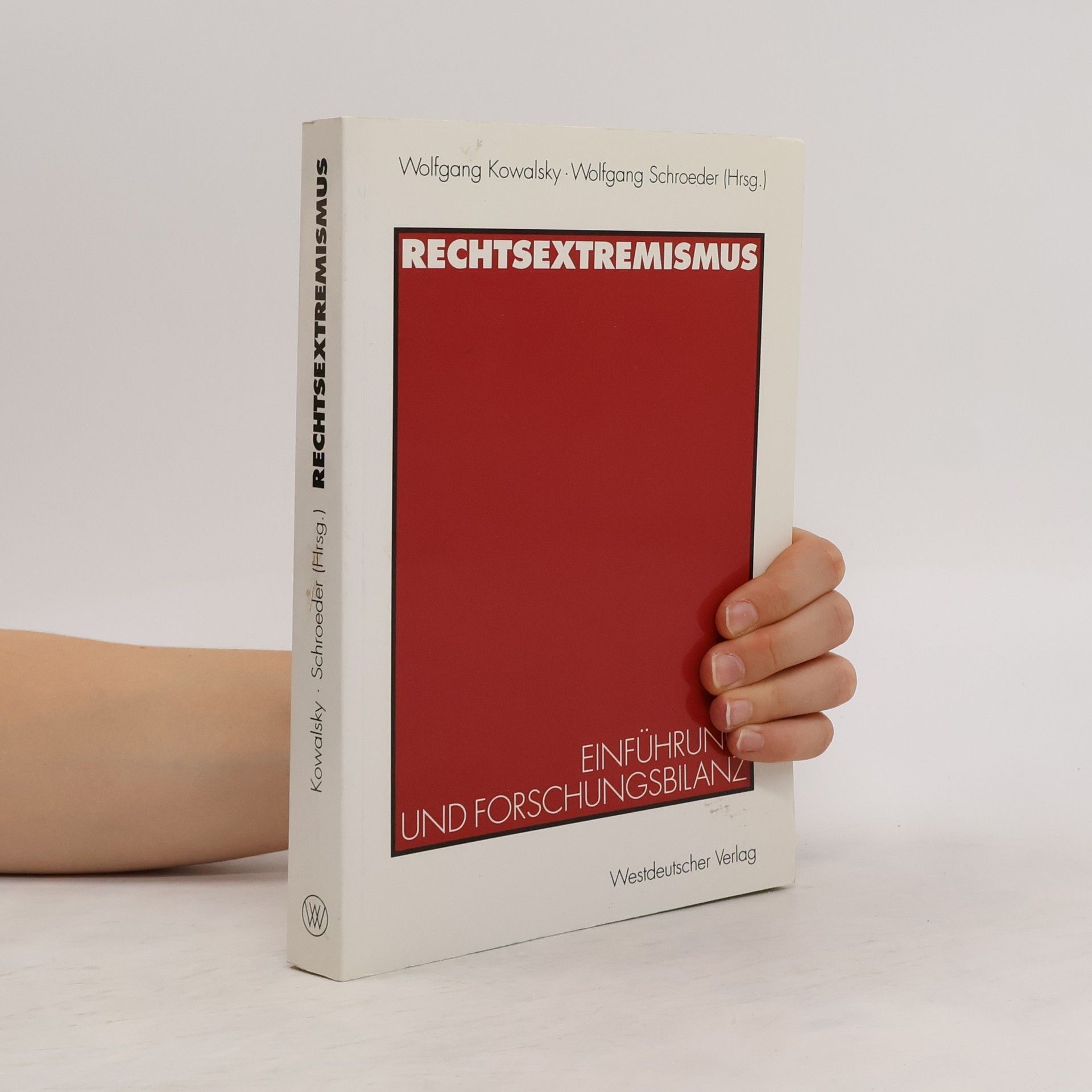

Rechtsextremismus
Einführung und Forschungsbilanz
Rechtsextremismus ist ein zentrales Thema, das seit den späten 80er Jahren die deutsche und internationale Öffentlichkeit stark bewegt. Um die politische Situation in Deutschland und die Veränderungen im Land zu verstehen, ist es wichtig, die Entwicklungen im Rechtsextremismus zu betrachten. Fragen stehen im Raum: Ist Deutschland nach der Wiedervereinigung und der neu erlangten Souveränität auf einem rechten Kurs? Werden rechtsextreme Parteien in deutschen und europäischen Parlamenten Fuß fassen und das Parteiensystem verändern? Gibt es eine Kontinuität zwischen den gegenwärtigen rechtsextremen Denk- und Handlungsmustern und denen des historischen Faschismus, insbesondere der NS-Zeit? Oder hat sich der Rechtsextremismus so gewandelt, dass er keinen Bezug mehr zum Nationalsozialismus benötigt, wie es bei der Partei „Die Republikaner“ der Fall sein könnte? Zudem stellt sich die Frage, ob eine steigende Akzeptanz für rechtsextremes Denken und Handeln in Deutschland zu beobachten ist. Eine terminologische Anmerkung: Die Übernahme des Begriffs „Nationalsozialismus“ und die Etablierung der „Republikaner“ als rechtsextreme Partei zeigen, wie solche Begriffe im gesellschaftlichen Diskurs verankert werden.