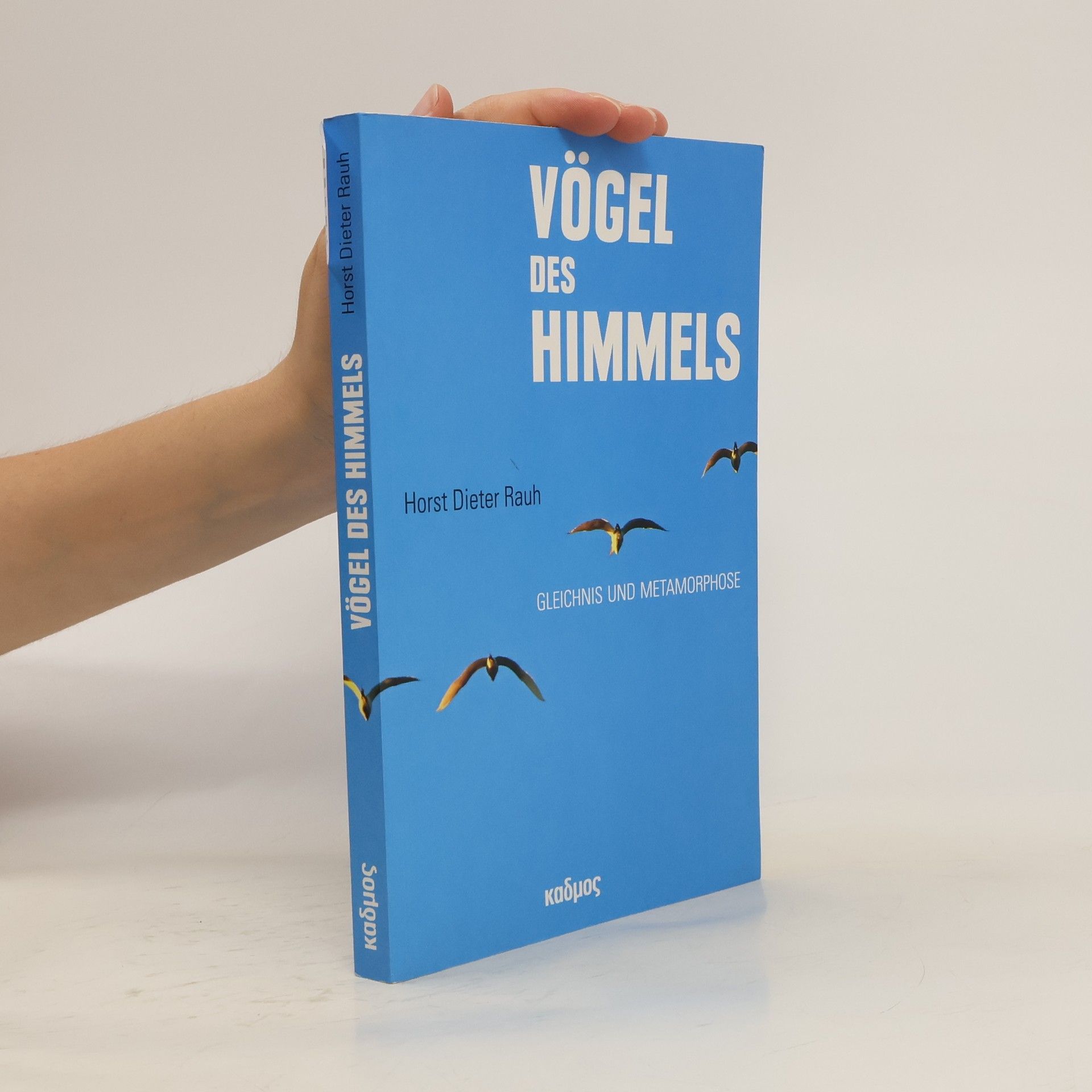Vögel des Himmels
Gleichnis und Metamorphose
Das kulturelle Gedächtnis überliefert unter zahlreichen Denkbildern auch biblische Metaphern; selbst in der Profankultur leben sie fort. Signifikantes Beispiel sind Naturbilder aus dem 6. Kapitel des Matthäus-Evangeliums: es geht um die Vögel des Himmels, die Lilien im Feld und das Gras. Das ursprünglich eschatologische Gleichnis wird seit der Romantik neu gelesen: Der Motivkomplex erlaubt vielfache Metamorphosen, verweist auf Sinnelemente in der Natur, inspiriert zu Wunsch- oder Drohbildern, zu Zeitkritik wie zu Fluchtfantasien. Die Vögel des Himmels werden zu Chiffren für kreative Freiheit und die Eskapismen des Individuums, die Lilien des Feldes zum Sinnbild des Widerstreits von Ethik und Ästhetik, das Weltreich des Grases zu einem Symbol, das für Vitalität wie für Vanitas steht. So reaktiviert die Moderne, der es an tragfähigen Symbolen fehlt, die biblischen Denkbilder auf ihrer Suche nach Sinnpotentialen. Einer sich entschieden profanierenden Kultur mit ihrer Ethik konsequenter Weltlichkeit, die gleichwohl ihre Defizite ahnt, senden sie weiterhin ihre Impulse. Vögel des Himmels –: die Metapher lebt.