Dieser Band bietet einen Gesamtüberblick der Entwicklung Preußens von den mittelalterlich-territorialen Wurzeln über die Phase der Aufklärung und des Nationalismus bis zu den letzten Krisen und der Auflösung Preußens im 20.Jahrhundert. Die Autorin zeigt Preußens Aufstieg zur Macht in Mitteleuropa, sie schildert aber auch ein «anderes» Preußen, die Formen nichtstaatlicher Modernisierung und politischer Partizipation sowie die Entwicklung einer eigenen Kultur.
Monika Wienfort Livres

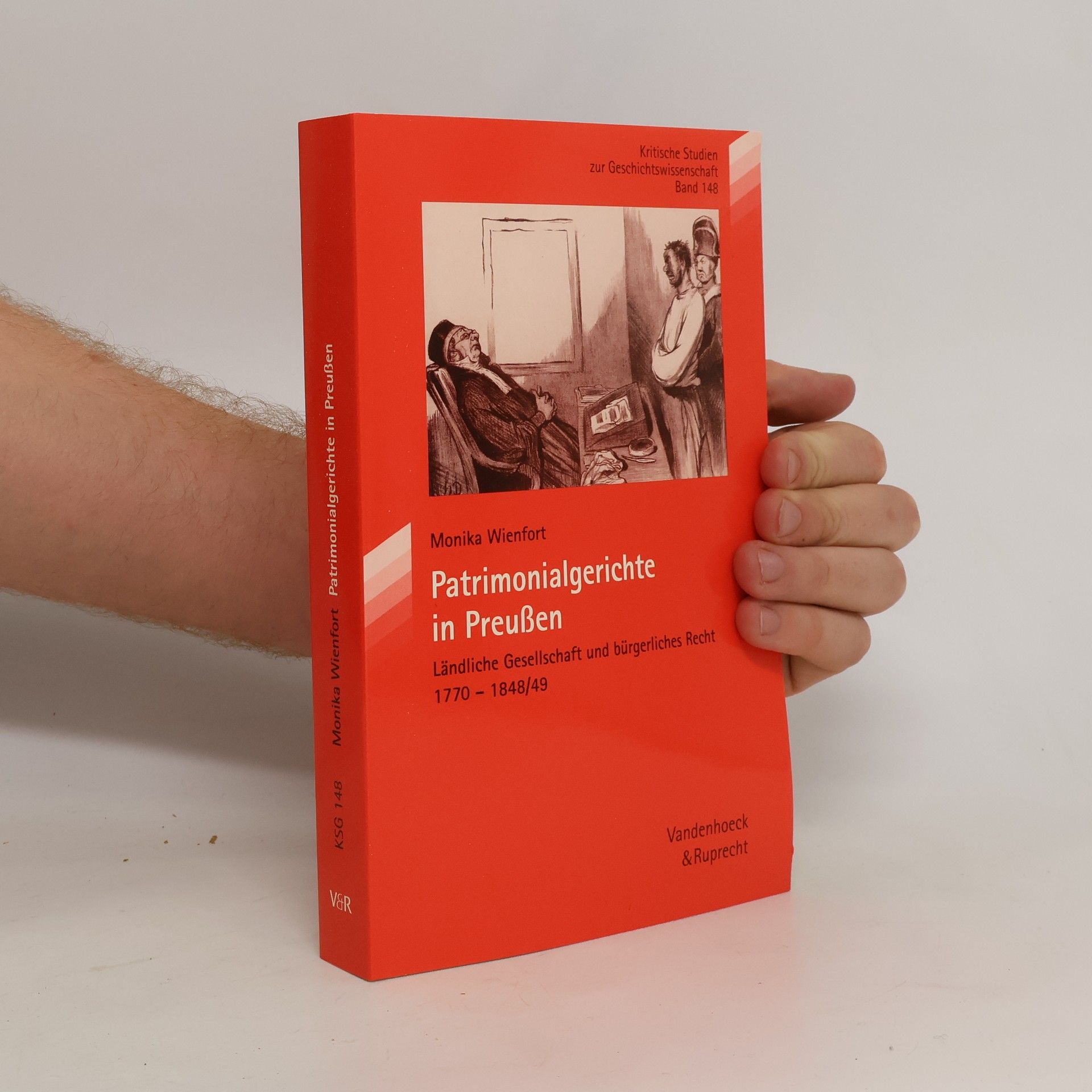

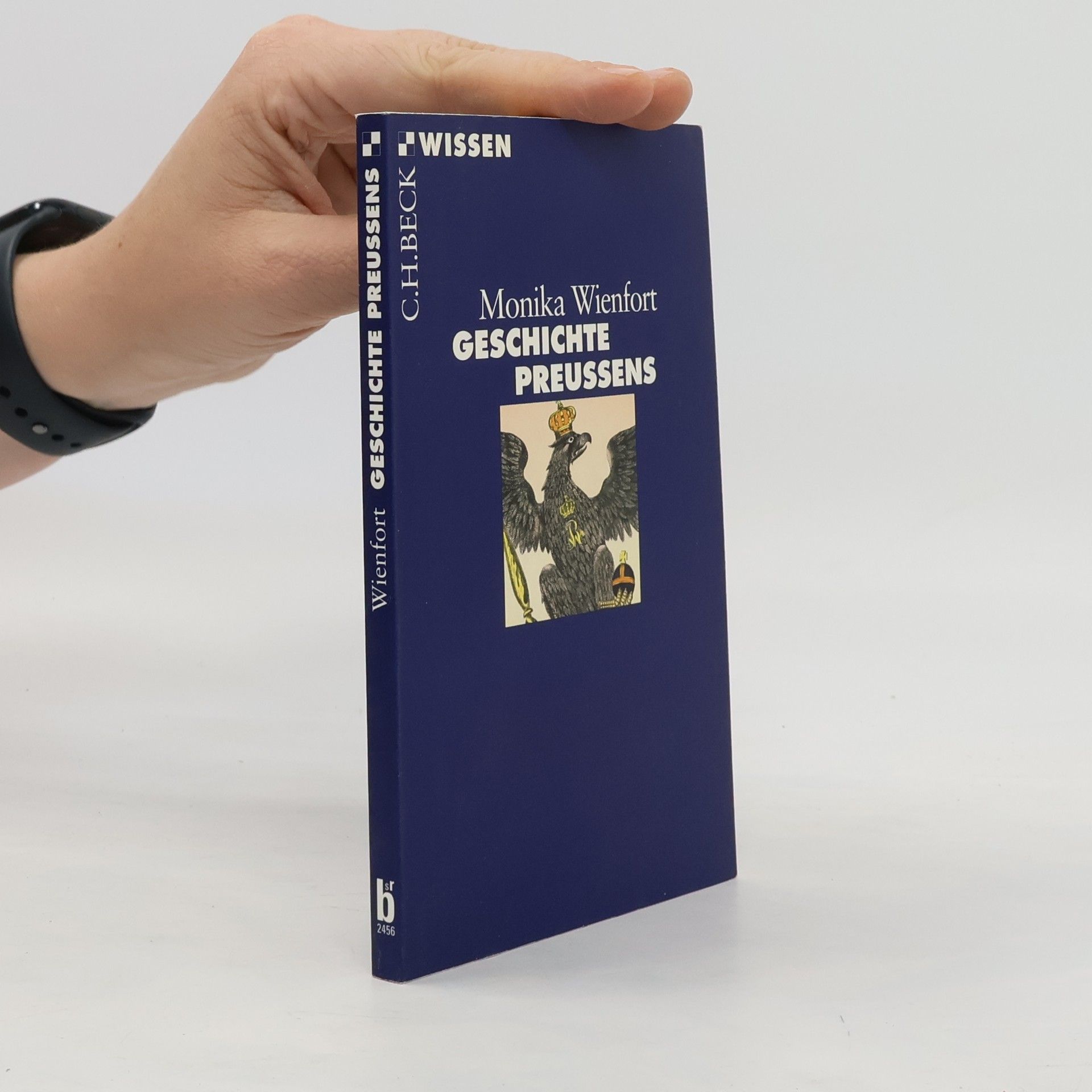
Die Bildungsstätte in Königstein im Taunus, gegründet von vertriebenen katholischen Priestern nach 1945, diente der Weitergabe der Frömmigkeitskultur und der Ausbildung von Priestern für den Osten. In den 1950er Jahren entwickelte sich hier ein Kommunikationszentrum, das über die Situation hinter dem Eisernen Vorhang informierte und die Kapellenwagenmission initiierte, um Gläubige in der westdeutschen Diaspora zu erreichen. Mit dem Tod der Gründungsgeneration in den 1970er Jahren gerieten die Unternehmungen in eine Krise, während das Ende des Kalten Kriegs die Erinnerung an die Nachkriegszeit prägte.
Die Patrimonialgerichtsbarkeit ist ein Mythos. Sie steht für die Rückständigkeit der politisch-sozialen Ordnung und die Beharrungskraft der konservativen Eliten in Preußen. Entspricht dieses Bild der Realität? Monika Wienfort zeigt in ihrer grundlegenden Untersuchung, dass sich die preußischen Patrimonialgerichte in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts von gutsherrlichen Verwaltungsinstanzen zu modernen Gerichten wandelten, bei denen vor allem die Rechtsangelegenheiten der ländlichen Eigentümer verhandelt wurden. Zunächst fragt sie nach der Rolle dieser Gerichte im Prozess der Staatsbildung, sodann nach den sozialen Beziehungen auf dem Lande und der ländlichen Wirtschaft. Schließlich geht es um den Wandel der ländlichen Rechtskultur unter dem Einfluss des Staates. Die Abschaffung der Patrimonialgerichtsbarkeit, die oft als eine der wenigen bürgerlichen Erfolge der Revolution von 1848/49 galt, stärkte vor allem den Staat. Die bürgerliche Gesellschaft verlor Partizipationsmöglichkeiten im Rechtssystem, die nur schwer zurückzugewinnen waren.
Hat die Ehe noch eine Zukunft? Angesichts der wachsenden Popularität nichtehelicher Lebensgemeinschaften vor allem in Europa scheint Skepsis angebracht. Monika Wienfort verfolgt die Geschichte der Ehe als Rechtsinstitut und Lebensform seit dem Aufkommen der Liebesehe im späten 18. Jahrhundert. Die Stationen einer Ehe werden vom Kennenlernen bis zum Ende, durch Tod eines Partners oder Scheidung, beschrieben. Es geht um staatliche Ehepolitik und den Wandel des Rechts, zum Beispiel bei der Versorgung von Geschiedenen und Hinterbliebenen. Die Aussteuer, die Hochzeitsreise und die Goldene Hochzeit haben ihre je eigene Geschichte. Das weiße Hochzeitskleid kam erst im 19. Jahrhundert in Mode, und neue Vorstellungen einer gelungenen Hochzeitsfeier breiteten sich aus. Eheberatung etablierte sich im 20. Jahrhundert und spiegelte gesellschaftliche und individuelle Erwartungen vor dem Hintergrund der Emanzipation der Frauen. Schließlich werden Ehepaare als Eltern Thema, das allmählich abnehmende Lebensrisiko der Mutterschaft, die steigende Berufstätigkeit von Müttern und die sich verändernden Erziehungsvorstellungen.