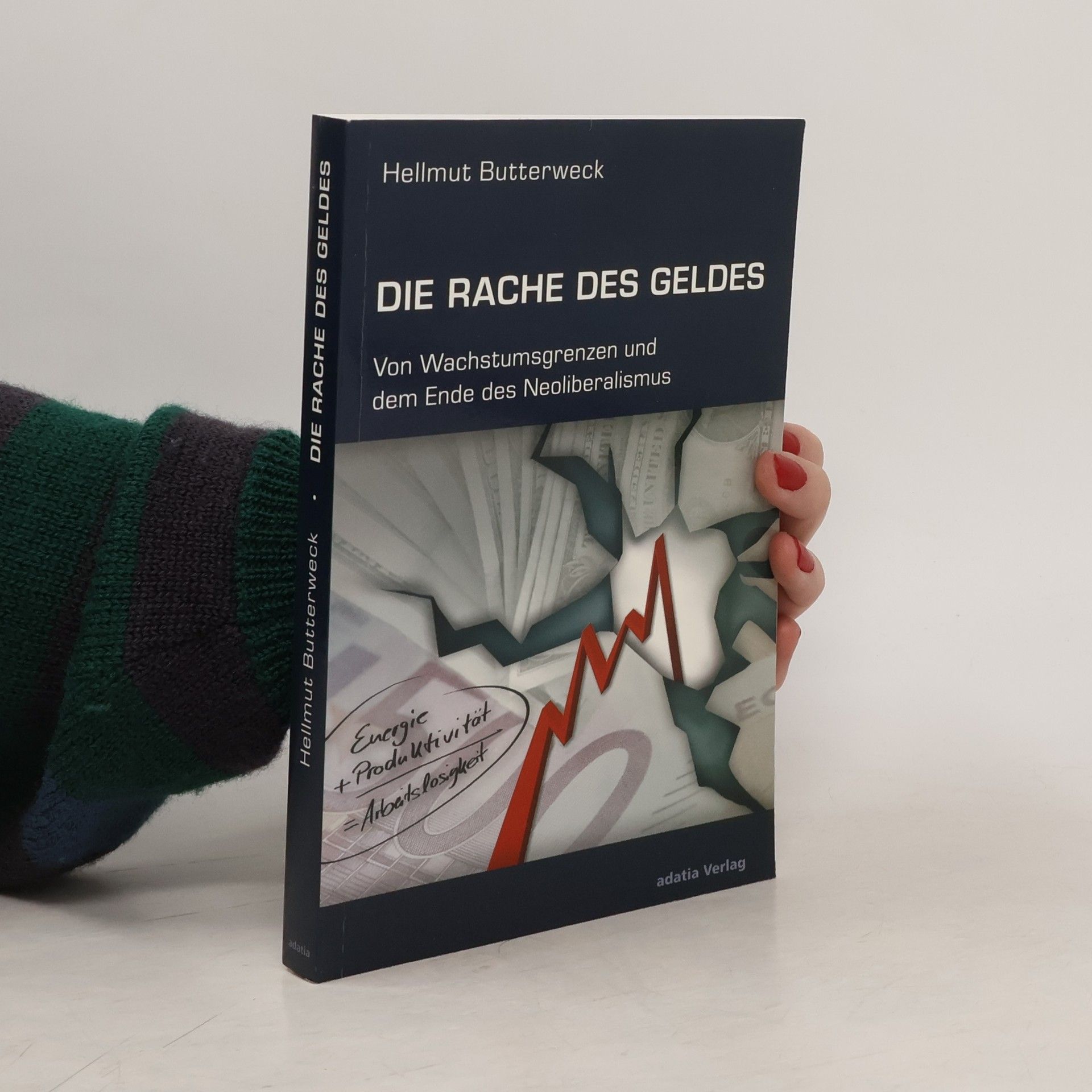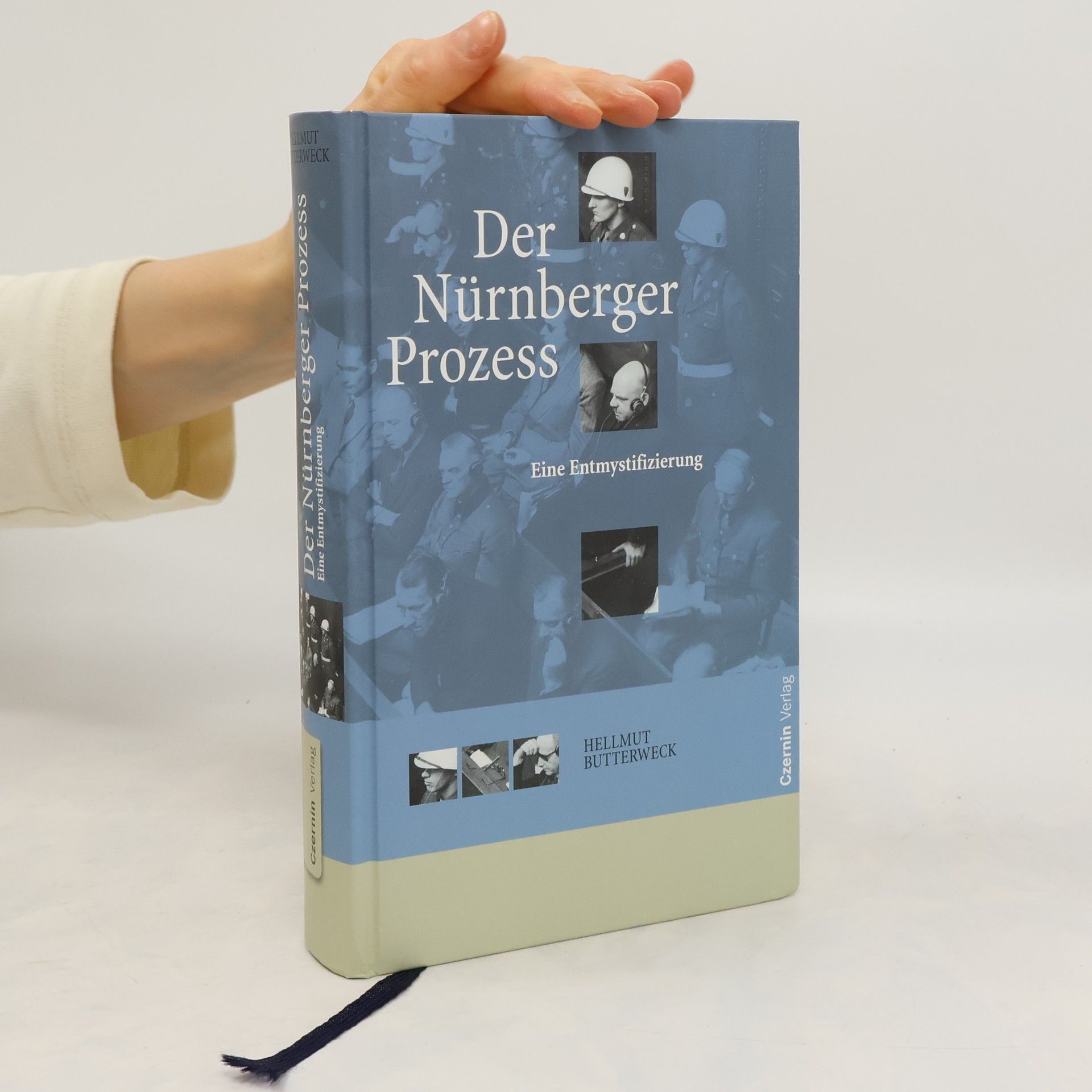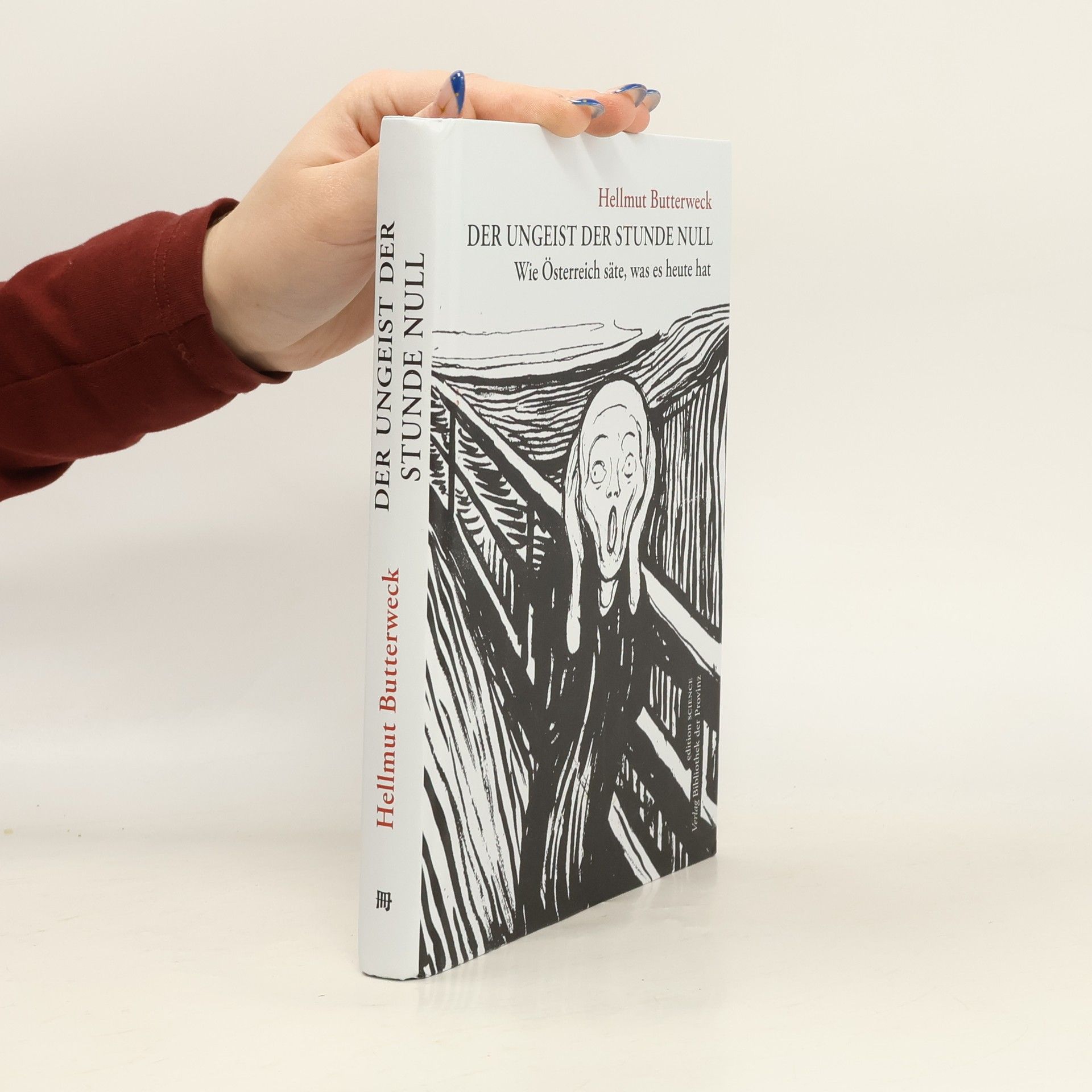Hellmut Butterweck Livres
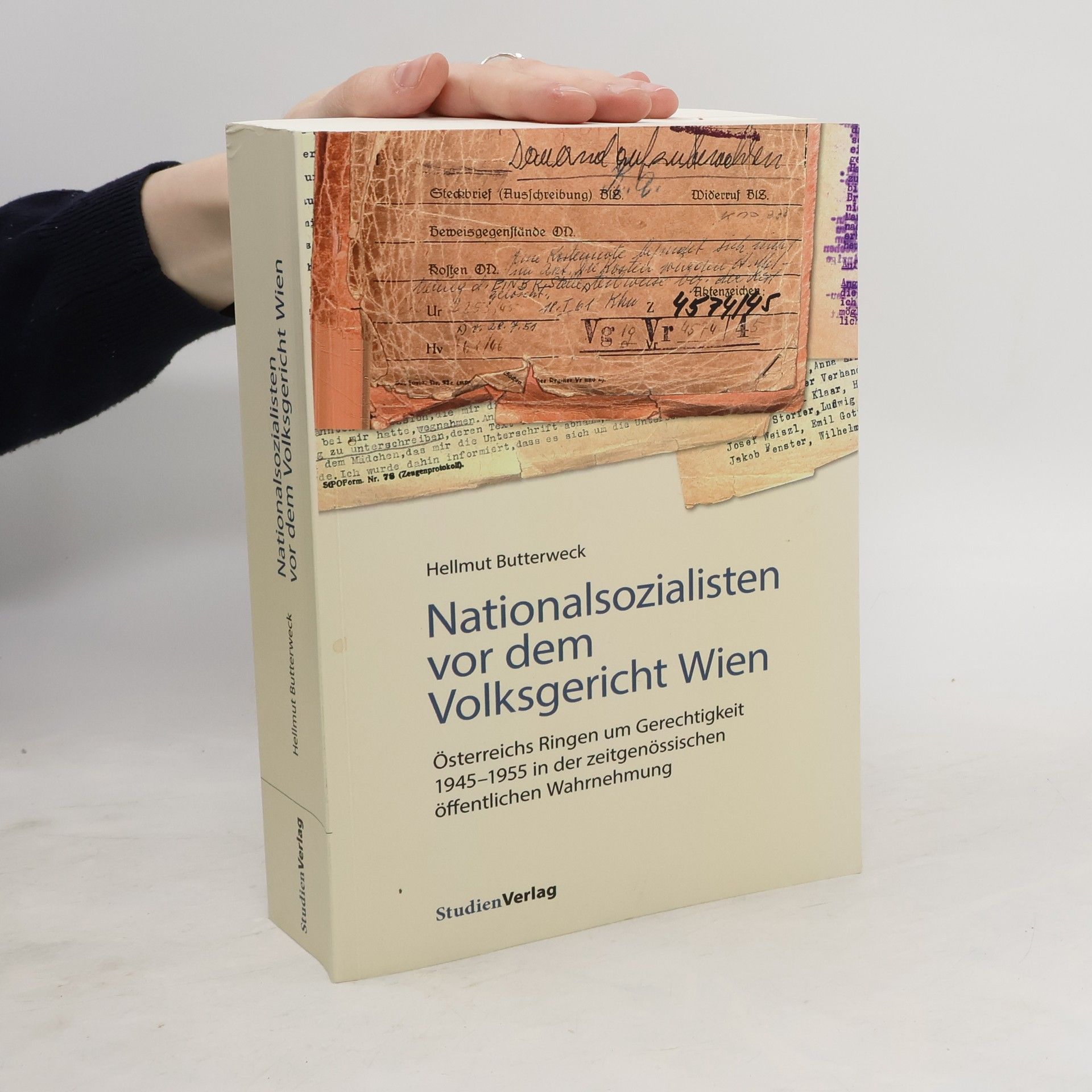
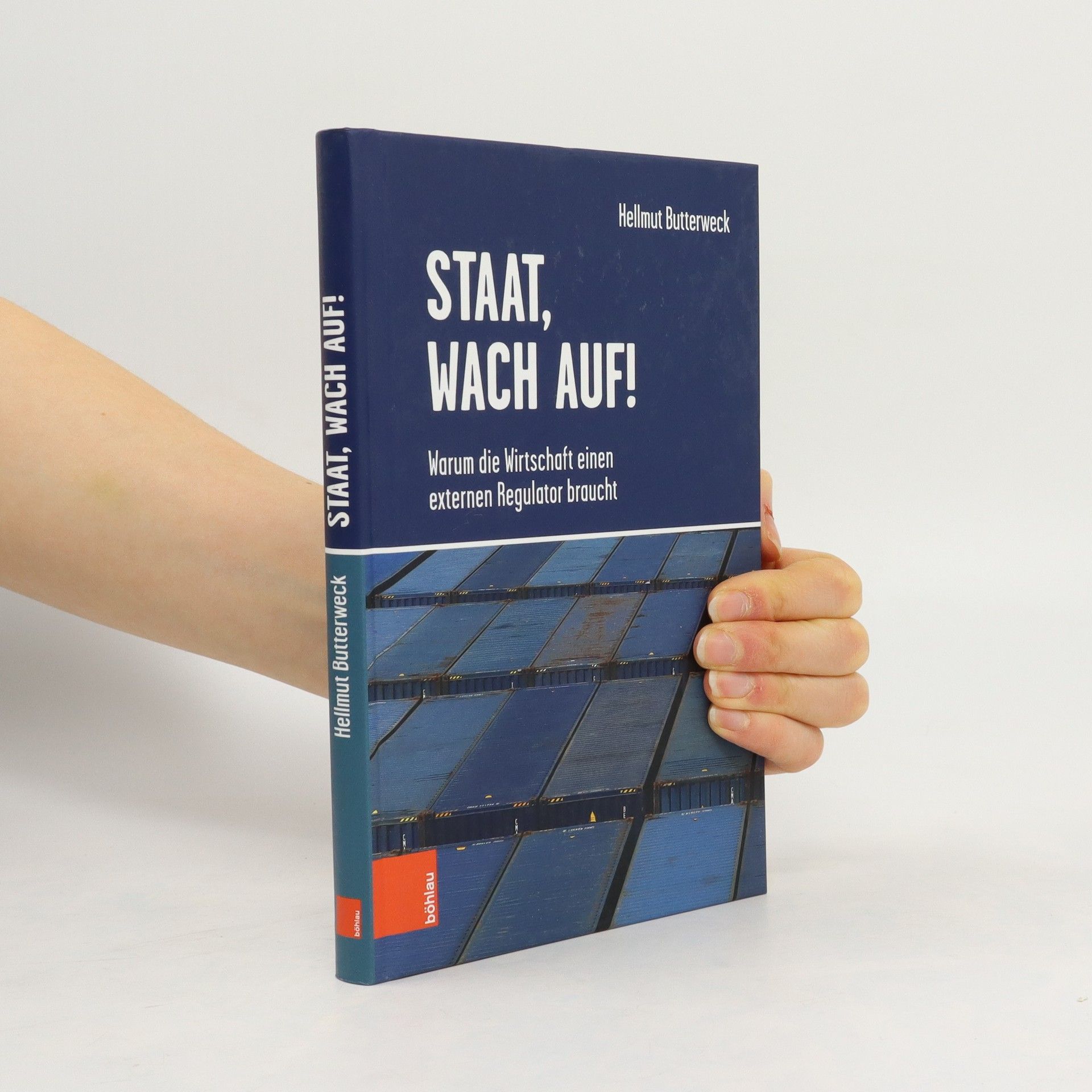
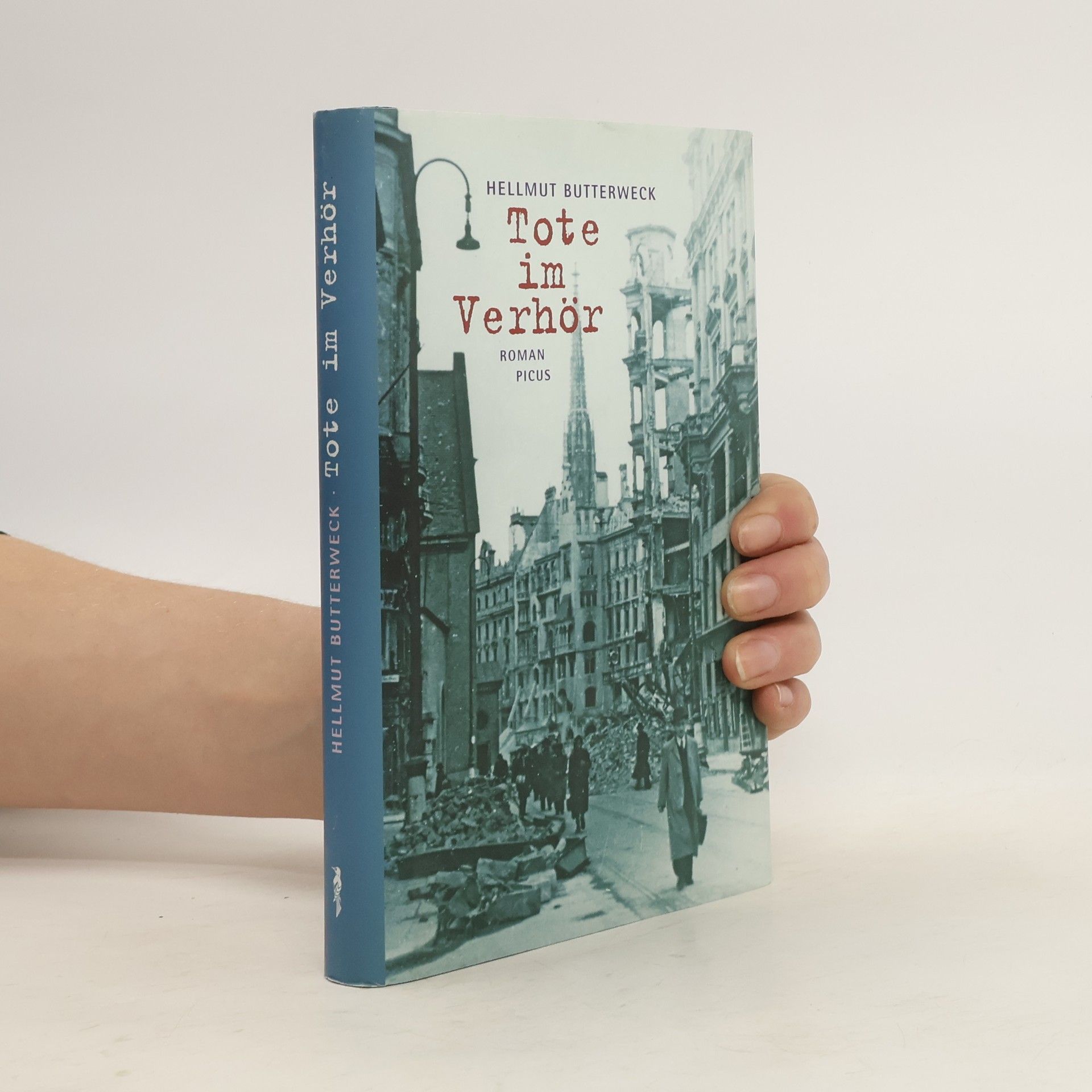

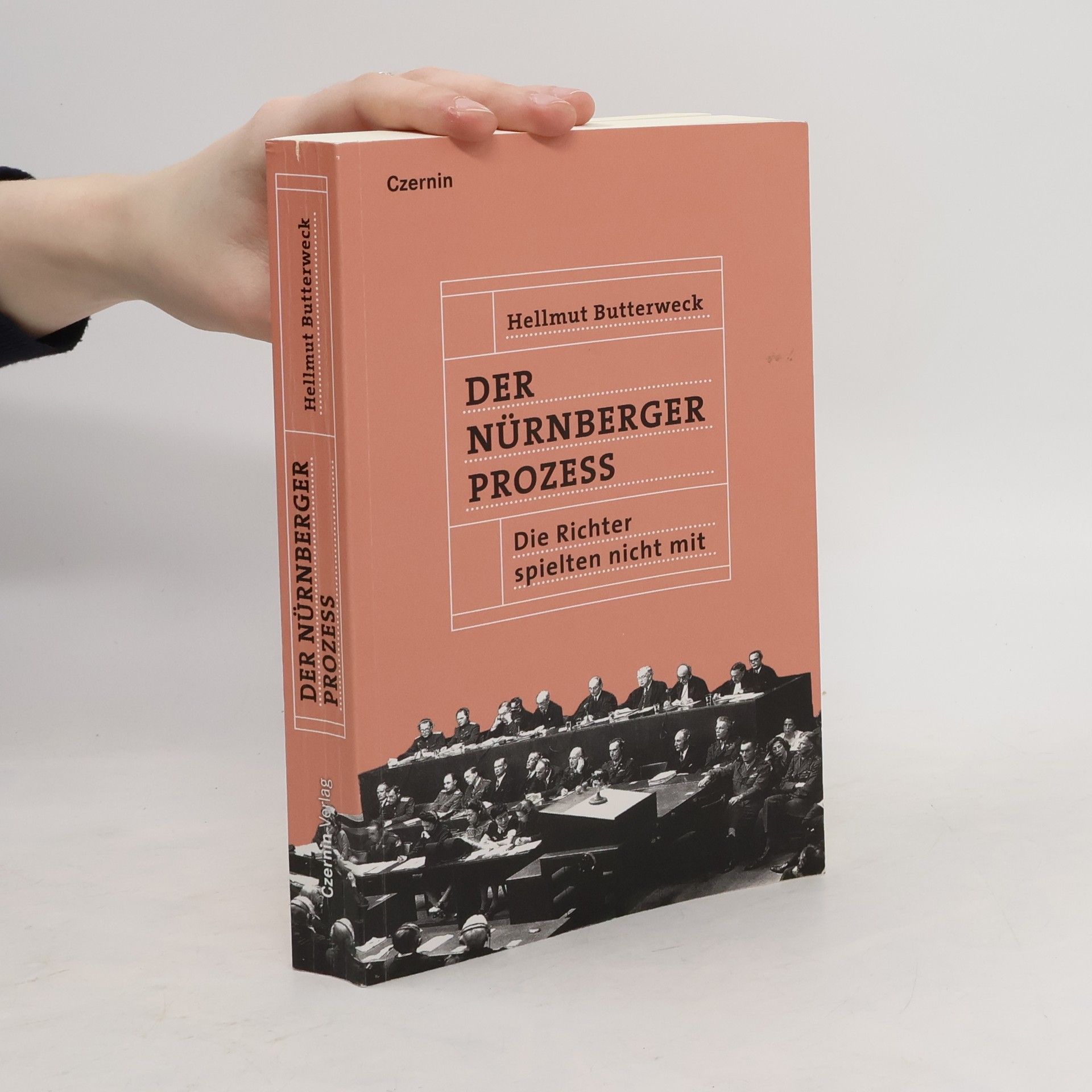

Der Nürnberger Prozess
Die Richter spielten nicht mit
Der Nürnberger Prozess ging als politischer Prozess in die Geschichte ein. So war er geplant und so nahm die Welt ihn wahr, weil der amerikanische Hauptankläger Robert Jackson nach den »Sternen eines neuen Völkerrechts« greifen und erstmals in der Geschichte Verbrechen gegen den Frieden bestraft sehen wollte. Dass die drei westlichen Richter mit ihrer Mehrheit gegenüber dem sowjetischen Mitglied des Tribunals aus dem Nürnberger Prozess etwas ganz anderes, nämlich einen reinen Mordprozess, gemacht hatten, wurde erst erkennbar, als die Strafen verkündet wurden. Hellmut Butterweck weist nach, dass mit einer Ausnahme ausschließlich die Schuld oder Mitschuld am Tod von Menschen entscheidend für die Strafen war. Schuldsprüche wegen Verbrechen gegen den Frieden wurden zwar ausgesprochen, fielen aber nicht einmal strafverschärfend ins Gewicht. Die Neuauflage dieses Werkes verknüpft im Gerichtssaal geführte Dialoge mit persönlichen Erinnerungen von Akteuren und gibt eine mögliche Antwort auf die Frage, inwiefern sich der Nürnberger Prozess als Modell für heutige Verfahren im Namen der Menschenrechte eignet.
Österreichs Kardinäle
- 223pages
- 8 heures de lecture
Österreichs Kirche im Spiegel ihrer höchsten Repräsentanten: Der Autor porträtiert die sieben Wiener Erzbischöfe und Kardinäle des 20. Jahrhunderts, zeigt ihre Verdienste ebenso wie ihr Versagen.
Drei Angeklagte stehen im Laufe des Jahres 1946 vor demselben Wiener Richter und beteuern ihre Unschuld. Nichts anderes als diese Tatsache verbindet sie. Der ehemalige Theatermann, der seine Mithäftlinge im KZ Auschwitz-Blechhammer als Blockältester gequält haben soll, der Feldarzt, dem Verrat an seinem Kommandeur vorgeworfen wird, und die Kunsthandwerkerin, die ihre jüdische Vermieterin auf dem Gewissen hat – sie kennen einander nicht und werden einander im Leben nie begegnen. Dennoch gibt es einen verborgenen Zusammenhang zwischen ihren Schicksalen. 'Meine Fantasie sei ein Hund an der Leine der Wirklichkeit' – dieses Leitmotiv steht über Hellmut Butterwecks Roman, in dem er die drei Einzelschicksale zu einer Spurensuche verknüpft, die sich eng an reale Fakten hält und erst dort, wo das dokumentarische Material schweigt, die Fantasie einspringen lässt. Butterwecks Tatsachenroman bietet nicht nur ein beklemmendes Bild der historischen Schnittstelle zwischen dem Nationalsozialismus und der unmittelbaren Nachkriegszeit, sondern führt darüber hinaus vor Augen, wie mangelhaft die Justiz der jungen österreichischen Republik mit der Aufgabe zurande kam, im Schatten der Terrorjahre dem Einzelnen Gerechtigkeit zukommen zu lassen.
Staat, wach auf!
Warum die Wirtschaft einen externen Regulator braucht
Temperaturrekorde, Überschwemmungen, Waldbrände, Sturmkatastrophen. Der Energieverbrauch steigt - und mit ihm der Kohlendioxid-Ausstoß. In den Supermärkten liegen die Produkte aus Fernost und Lateinamerika, Europa kämpft mit der Arbeitslosigkeit. Die steigt, sobald das Wirtschaftswachstum nachlässt. Angeblich werden wir immer reicher, aber immer mehr Menschen merken nichts davon. Wie soll das weitergehen? Die Politik hört auf die Ökonomen, die uns seit 200 Jahren erzählen, die Wirtschaft sei ein sich selbst regelndes System, in dem der Staat nur Schaden stifte, wenn er sich zu sehr einmische. Das Gegenteil ist der Fall, behauptet der Autor dieses brillant geschriebenen Buches. Der Staat muss als externer Regulator in die Wirtschaft eingreifen, die Globalisierung muss auf ein verträgliches Maß zurückgeschraubt werden. Hellmut Butterweck vollzieht den überfälligen Bruch mit den Dogmen, welche die Wirtschaftswissenschaft daran hindern, auf die Warnungen der Naturwissenschaftler adäquat zu reagieren. Nur ein Außenseiter konnte das so schreiben. Staat, wach auf! ist geeignet, dem ökonomischen Denken eine neue Richtung zu geben.
Nationalsozialisten vor dem Volksgericht Wien
Österreichs Ringen um Gerechtigkeit 1945-1955 in der zeitgenössischen öffentlichen Wahrnehmung
Österreichische Gerichte fällten zwischen 1945 und 1955 über 13.000 Urteile gegen NS-Verbrecher, und Hellmut Butterweck beleuchtet diesen Justizkomplex. Er zeigt die extremen Unterschiede in den Urteilen, etwa zehn Jahre für einen Ortsgruppenleiter, der Juden half, und nur ein Jahr für einen Lagerleiter, unter dessen Herrschaft Roma in unmenschlichen Bedingungen leben mussten. Gerechtigkeit hing oft vom Datum und dem jeweiligen Richter ab. Das Buch vermittelt die emotional aufgeladene Atmosphäre der frühen Nachkriegszeit und die Enttäuschung der NS-Gegner über die rasche, falsche „Befriedung“. Butterweck dokumentiert die Prozesse des Volksgerichtes Wien von 1945 bis 1955, die in zeitgenössischen Wiener Tageszeitungen festgehalten sind, in chronologischer Reihenfolge. Durch Zitate aus Gerichtssaalberichten entsteht ein lebendiges Bild der fast vergessenen Auseinandersetzung der österreichischen Justiz mit NS-Verbrechen und ein neuer Blick auf den Alltag während der Nazizeit. Die umfassende Dokumentation und Analyse machen dieses Werk zu einer unverzichtbaren Quelle für die Forschung zur Nachkriegszeit, wie Univ.-Prof. DDr. Oliver Rathkolb vom Institut für Zeitgeschichte der Universität Wien feststellt.
Arbeitslosigkeit, Staatsverschuldung, Armut? „Mehr Wachstum“ hieß das Allheilmittel vor der aktuellen Weltwirtschaftskrise. Und weiteres Wachstum soll nun aus der Krise führen. Dabei ist „mehr Wachstum“ nicht die Lösung, sondern Teil des Problems. Das Wachstumsdogma scheitert nicht nur an den Grenzen der Natur. Den dicksten Strich durch die Rechnung macht die Arbeitslosigkeit. Hellmut Butterweck erschüttert nicht nur den Wachstumsglauben, sondern belegt, dass der laufende Verlust von Arbeitsplätzen durch die Zunahme der Produktivität und die Verdrängung menschlicher Arbeitskraft durch billigere Energie das drängendste Problem entwickelter Industriegesellschaften ist. „Die Raches des Geldes“ ist die notwendige Ergänzung zur ökologischen Wachstumskritik. Der Autor erzählt, wie das ökonomische Denken im Konflikt zweier großer Schulen erstarrte und entlarvt die Deregulierer und Wachstumsprediger als Wiedergänger längst untergegangener Theorien. Er analysiert die Schwierigkeiten, die am Übergang zu einer wachstumsarmen Wirtschaft stehen und eröffnet mit konkreten Vorschlägen für ein alternatives wirtschaftspolitisches Instrumentarium den Diskurs über die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit mit neuen Mitteln.
Vor 60 Jahren, am 20. November 1945, wurde der Nürnberger Prozess eröffnet. Er war ein faszinierendes, hochdramatisches Ereignis. Er wird bis heute verzerrt, verleumdet und mystifiziert. Die Entmystifizierung des Nürnberger Prozesses, die neue Darstellung und die neue Bewertung ist überfällig. Dies alles ist in diesem Buch auf souveräne Weise gelungen. Hellmut Butterweck schrieb eine spannende neue Darstellung mit dem Prozessgeschehen im Mittelpunkt, reich an Höhepunkten, mit zahlreichen im Gerichtssaal geführten Dialogen. Er stützt sich nicht nur auf die offiziellen Protokolle, sondern auch auf die persönlichen Erinnerungen von Anklägern wie Telford Taylor oder Robert Kempner, von Verteidigern wie Gustav Steinbauer oder Alfred Seidl, von Angeklagten wie Hans Fritzsche oder Albert Speer und auf die jüngste Literatur. Er behandelt ausführlich das Zustandekommen des Tribunals, analysiert die Urteile und gibt neue, schlüssige Antworten auf immer wieder gestellte Fragen: Gab es Alternativen zum Nürnberger Prozess? Wie fair wurde er geführt? Wie gerecht waren die Urteile? Warum stellen nicht nur die Ewiggestrigen den Nürnberger Prozess verzerrt und einseitig dar? Warum haben ihn auch die Sieger des Zweiten Weltkrieges verdrängt?
Edition Science: Der Ungeist der Stunde Null
Wie Österreich säte, was es heute hat