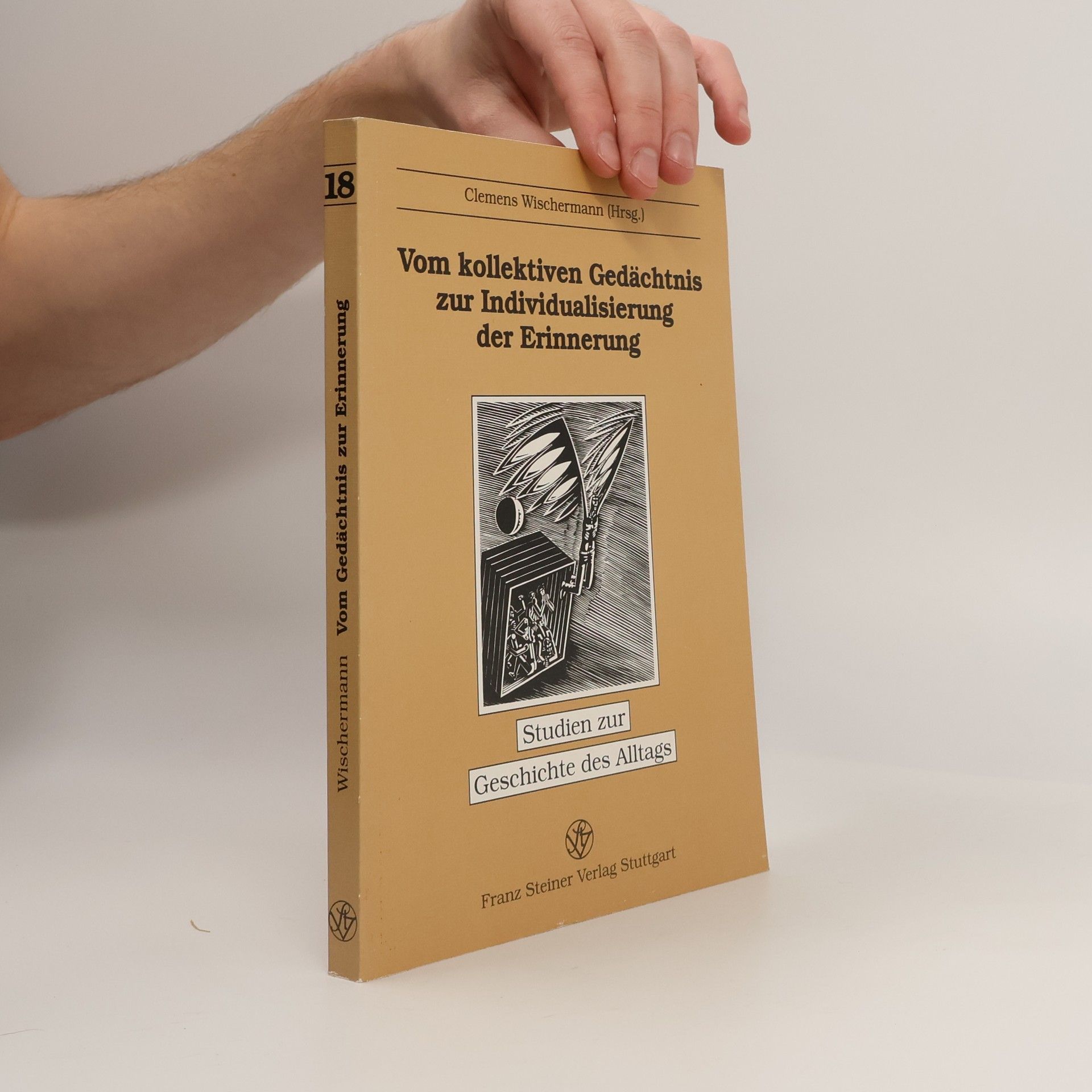Studien zur Geschichte des Alltags - 18: Vom kollektiven Gedächtnis zur Individualisierung der Erinnerung
- 203pages
- 8 heures de lecture
Inhalt: Clemens Wischermann: Kollektive, Generationen oder das Individuum als Grundlage von Sinnkonstruktionen durch Geschichte: Einleitende Überlegungen Uta Rasche: Geschichtsbilder im katholischen Milieu des Kaiserreichs: Konkurrenz und Parallelen zum nationalen Gedenken Miriam Gebhardt: Zur Psychologie des Vergessens: Antisemitismus in jüdischen Autobiographien vor und nach 1933 Stefan Zahlmann: Die besten Jahre? DDR-Erinnerungskultur in Spielfilmen der DEFA t Helke Stadtland: Vergangenheitspolitik im Widerstreit. Ausgrenzung, Amnestie und Integration in der Gründungsphase der ostdeutschen Gewerkschaften Katja Patzel-Mattern: Jenseits des Wissens – Geschichtswissenschaft zwischen Erinnerung und Erleben Sandra Markus: 'Schreiben heißt: sich selber lesen.' Geschichtsschreibung als erinnernde Sinnkonstruktion Matthias Dümpelmann: Maler des eigenen Lebens. Individuelle Identität zwischen Erinnern und Vergessen Auswahlbibliographie – Biographische Selbstnotizen