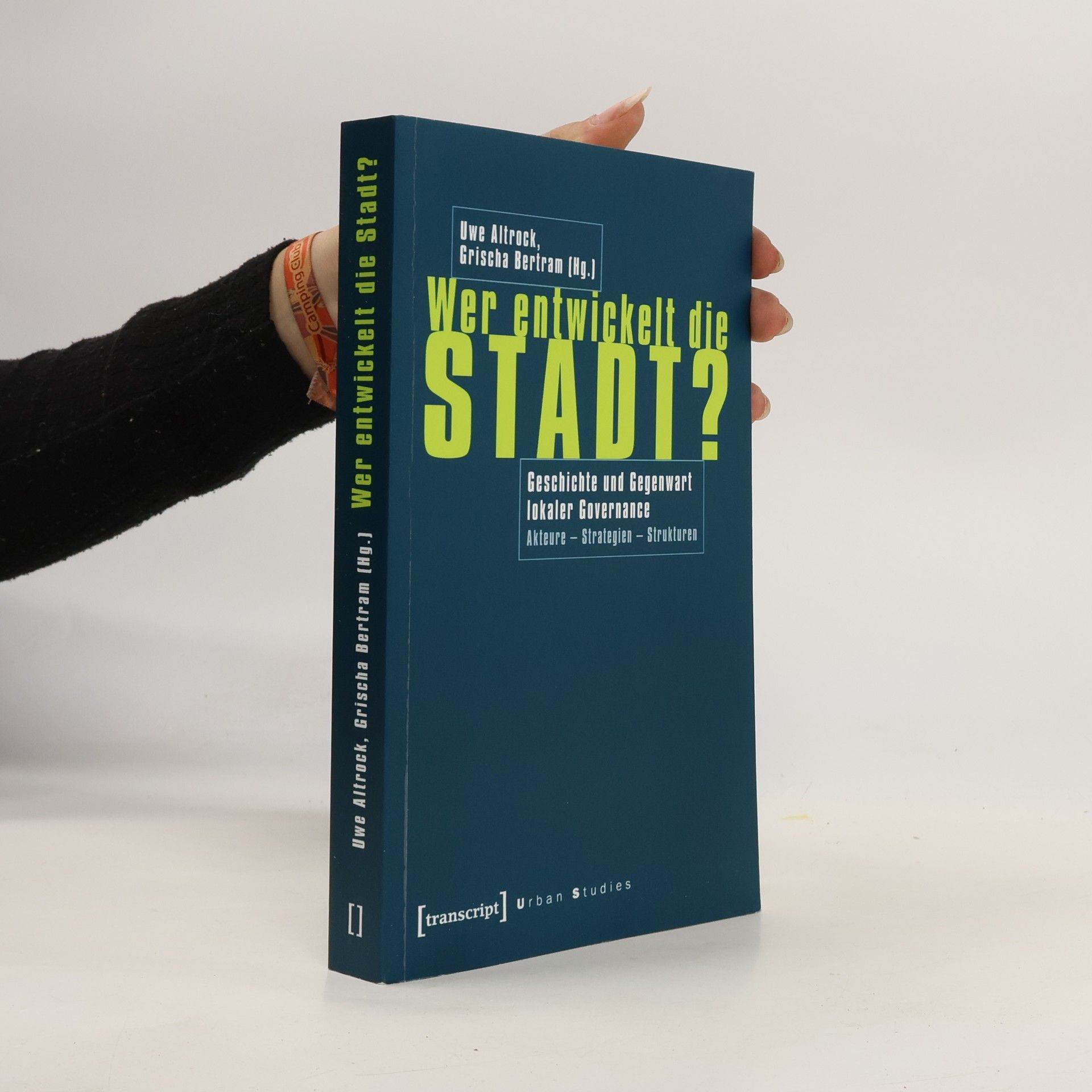Stadterneuerung und Spekulation
Jahrbuch Stadterneuerung 2022/23
Was richten öffentliche Eingriffe gegen das Geschäft mit Boden und Immobilien aus? Diese Frage ist der Anlass für eine Bestandsaufnahme aus der Perspektive der Stadterneuerung – deren Umgang mit privaten Verwertungsinteressen, baulich-räumlicher Aufwertung und sozialer Verdrängung. Es wird ein Bogen gespannt von den Folgen globaler Finanzkrisen und den Raumpotenzialen in Städten über kommunale Strategien im Umgang mit Wohnungsfragen und den Handlungsstrategien wohnungswirtschaftlicher Akteure bis hin zu Regulierungsansätzen in Stadterneuerungsprozessen. Die Sammlung spannender Beiträge aus verschiedenen Disziplinen verknüpft in der Zusammenschau die Wohnungs- und Bodenfrage mit der Programmatik der Stadterneuerung.