Campus der Religionen
Eine weltweit einzige Initiative in Wien – Seestadt Aspern
- 119pages
- 5 heures de lecture
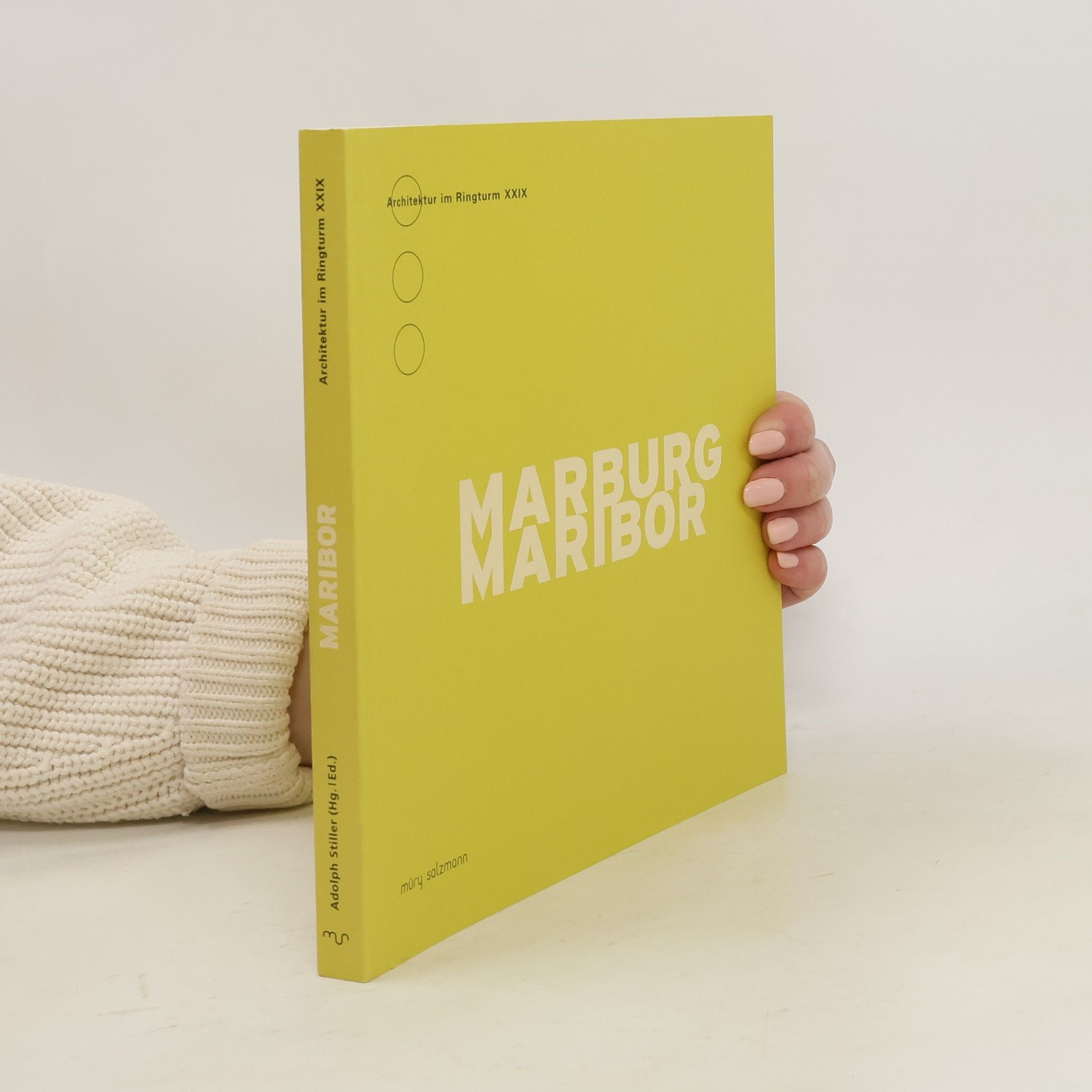
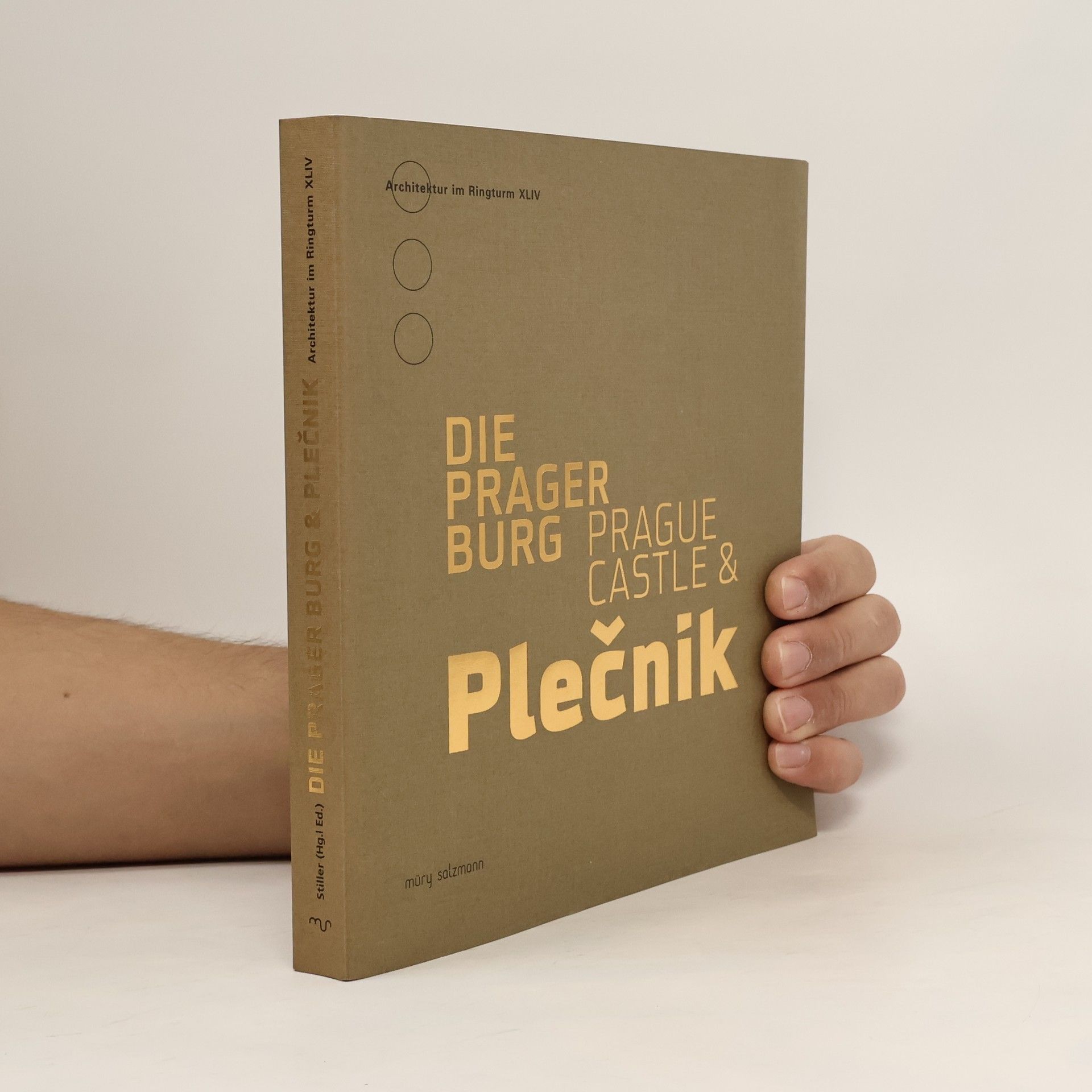



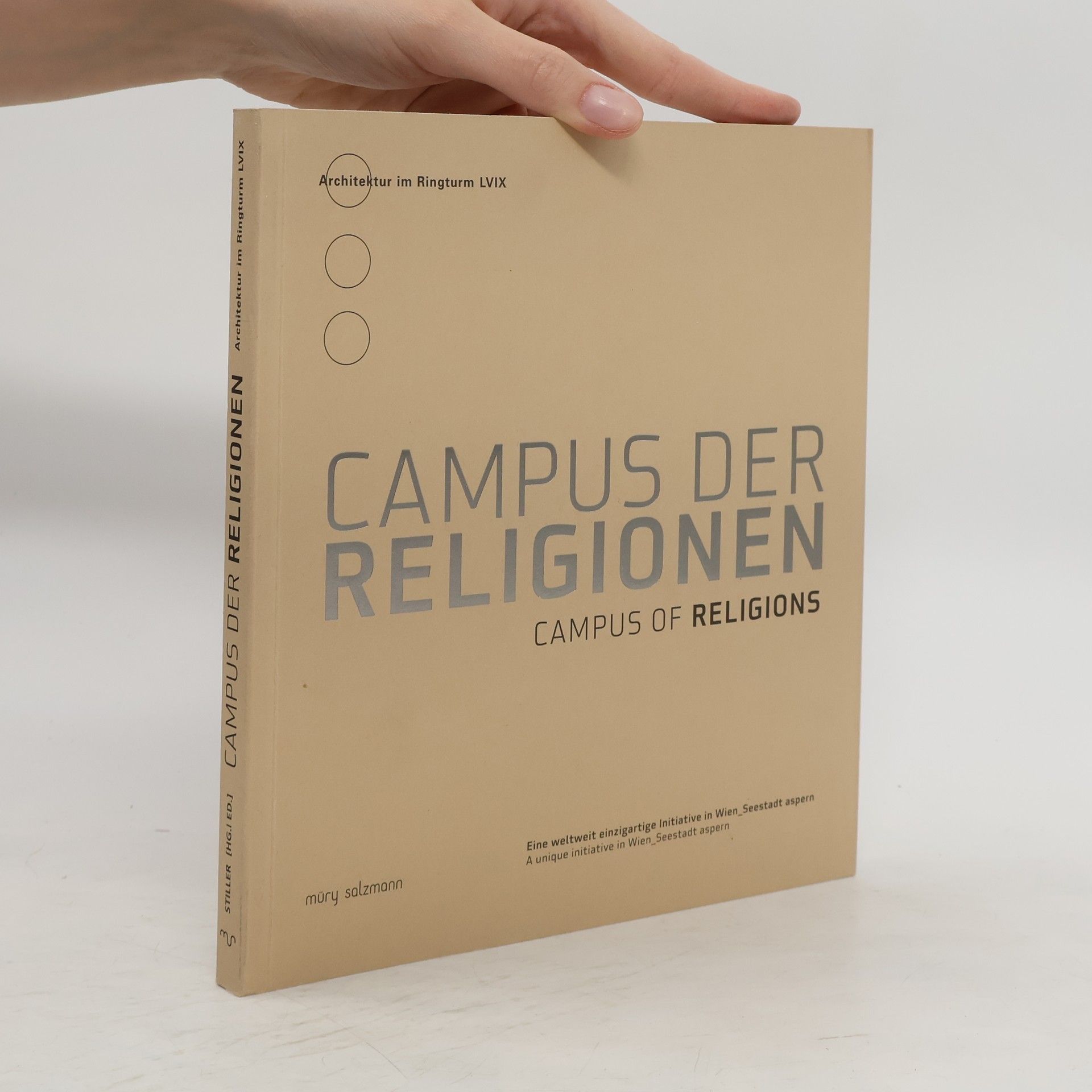
Eine weltweit einzige Initiative in Wien – Seestadt Aspern
Sparsame Räume für die Zukunft
Das Buch schildert die bewegte Geschichte Tiranas seit dem Ende des 19. Bis zum Beginn des 21. Jahrhunderts. Als die Habsburgermonarchie versuchte Albanien (1914-18) zu kolonisieren entstand erstmals eine gezielte Stadtplanung. Ausgehend vom nordalbanischen Shkodra, wo das Zentrum der militärischen Präsenz eingerichtet wurde, begann man das Land von dem seit maria-theresianischen Zeiten bewährten militärgeografischen Institut zu vermessen. Erstmalig wurden Stadtpläne und teilweise sogar Katasterpläne erstellt. Die Phase der Unabhängigkeit nach dem 1. Weltkrieg fand im April 1939 sein Ende, als das faschistische Italien Albanien unterwarf und das Italienisch-Albanische Königtum geschaffen wurde und die italienische Gesetzgebung auch im städtebaulichen Bereich angewandt wurde. Unter der Diktatur Enver Hoxhas verschwand Albanien hinter einer vollkommenen Abschottung. Das Buch dokumentiert auch diese Phase aus architektonischer Sicht und zeigt die unkonventionellen Ansätze nach dem Ende dieses politisch isolierten Regimes. Ein Fotoessays, persönliche Statements der Autoren und ein Interview mit Bürgermeister Edi Rami geben höchst informative Einblicke in das Leben dieser Hauptstadt.
Josef Plečniks Arbeiten in Wien und Prag (für Präsident Masaryk) sind einigermaßen bekannt, weniger jedoch sein vielfältiges, bewundertes Schaffen in Slowenien. Als in den 1980er-Jahren Architekturexperten nach Ljubljana pilgerten, weil sie in Plečnik den geistigen Vater der Postmoderne sahen, war dies ein grobes Missverständnis. Plečnik, einer der bedeutendsten Otto Wagner-Schüler und origineller Grenzgänger zwischen Okzident und Orient (mit großem Respekt für die Volkskultur), hat sich stets für die möglichen Metamorphosen der klassischen Architektur interessiert und es darin zu einem außergewöhnlichen Formenreichtum gebracht; nie aber war er an ‚Architekturzitaten‘ interessiert. Er orientierte sich stets an Wien um 1900, knüpfte an die Architekturthemen seines Lehrers immer wieder an und entwickelte sich danach zur eigenständigen Antithese (wie etwa Gunnar Asplund in Schweden, Hans Döllgast in Bayern oder Dimitris Pikionis in Griechenland). Plečnik hat in Ljubljana und an verschiedenen Orten Sloweniens Staunenswertes geschaffen; er ist für die breite Masse – zu ihrem Glück – noch zu entdecken! Dieses Buch enthält neben exquisitem Bildmaterial Texte von Damjan Prelovšek, Boris Podrecca und Adolph Stiller.
Eigentlich merkwürdig: Obwohl die Doktrinen des Sowjetimperiums, auch auf kulturellem Gebiet, für Polen bindend waren, fielen die von Le Corbusier, Walter Gropius, Josef Frank, Gerrit Rietveld und vielen anderen geborenen Ideen der CIAM in dem Ostblockstaat bis in die 1960er Jahre auf fruchtbaren Boden. Auch einen Aufbruch zu Formen der Spätmoderne gab es im gesamten Bereich der Kultur zu beobachten, ähnlich wie in den Bruderstaaten Bulgarien, Rumänien, Jugoslawien und sogar Albanien. Der 60. Band der Reihe „Architektur im Ringturm“ bereitet den Anteil Krakaus – bis zum Ende des Ersten Weltkriegs Teil der k. k.-Monarchie und deshalb für Österreich von besonderem Interesse – an der Architektur der polnischen Moderne erstmals gesammelt auf.
War es auf Initiative des weißrussischen Tourismusverbandes, dass EU-Bürger*innen nunmehr ohne Visum einreisen können? Dreißig Tage dürfen sie bleiben – genügend Zeit, um sich einen Eindruck von dem zwischen Polen, Litauen, Lettland, Russland und der Ukraine gelegenen Land zu verschaffen. Die Reihe „Architektur im Ringturm“ leistet einmal mehr Pionierarbeit. Ihr 59. Band dokumentiert die eindrücklichsten Bauten der 1950er bis 1970er Jahre, die sich nach den großen Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs in Minsk in einzigartiger Weise erhalten haben. Namhafte Architekten aus dem gesamten ehemaligen Sowjetreich haben sich ins Stadtbild eingeschrieben. Jüngste Entwicklungen weisen gigantische Bauvolumina besonderer Prägung auf; auch sie werden in Wort und Bild vorgestellt. Mit diesem Band dürfte Minsk jedenfalls seinen Ruf der „unbekanntesten Hauptstadt Europas“ verlieren.
Die „langen 1950er Jahre“ – heute in der Jugendkultur sowie im Design- und Modebereich mitunter nostalgisch verklärt – sind irgendwann doch vorüber gegangen, Stalin hat das Zeitliche gesegnet, und Chruschtschow konnte seine Reformen, vor allem im Bereich der Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik, der Bildung und Kultur initiieren. Ein neuer Aufbruch zeichnet sich am Horizont der ehemaligen Staaten des Warschauer Pakts ab. Die politischen Umwälzungen bereiteten im Ungarn der 1960er- und 1970er-Jahre den großteils noch von der klassischen Moderne geprägten Architekten das Feld für eine Reihe von hervorragenden Bauten. Diese stellt der 46. Band der Reihe „Architektur im Ringturm“ in gewohnt profund recherchierter Manier vor und blickt zugleich hinter die Kulissen eines Landes in einer Zeit, wo andernorts die Antibabypille auf den Markt kam und die ersten Schritte auf dem Mond gemacht wurden.