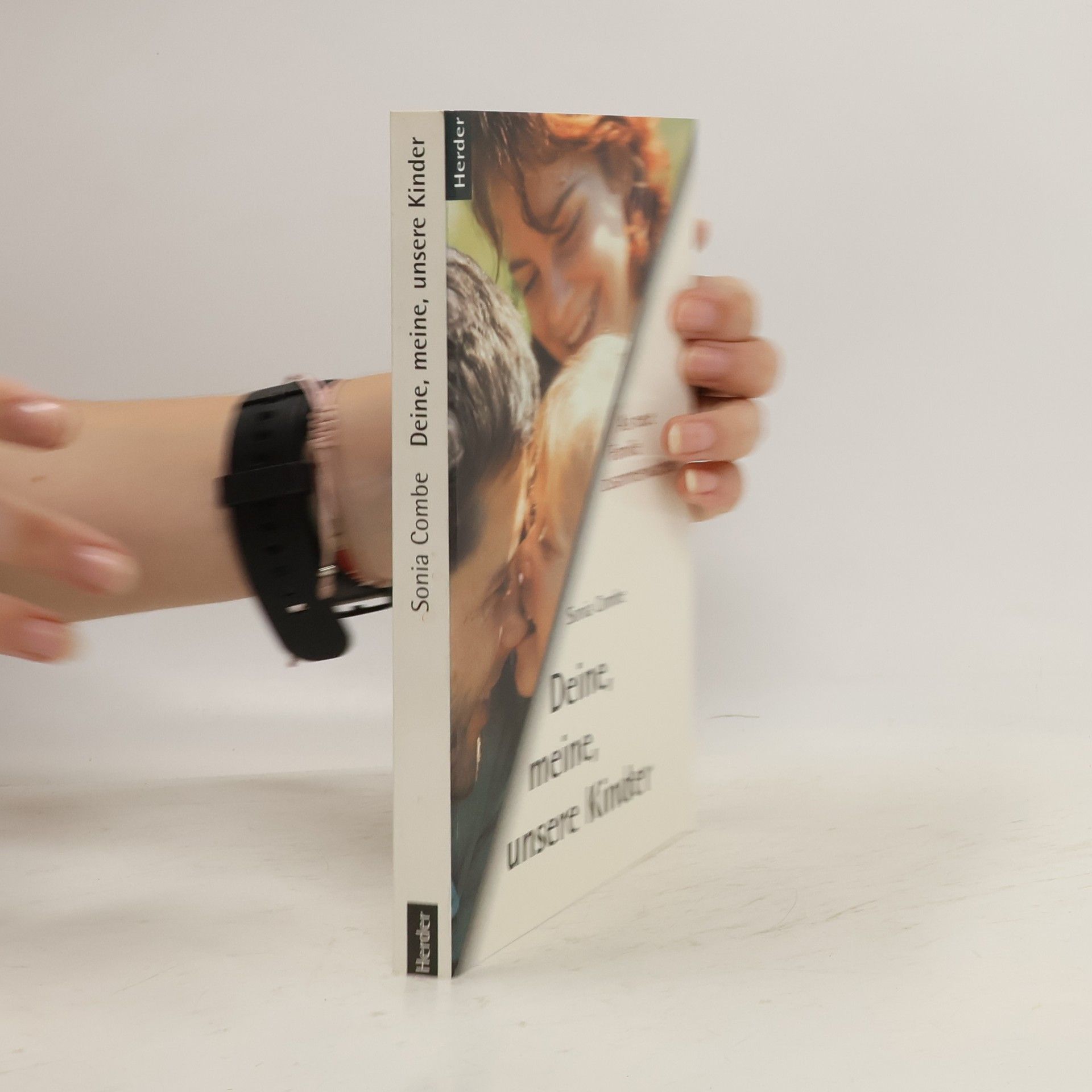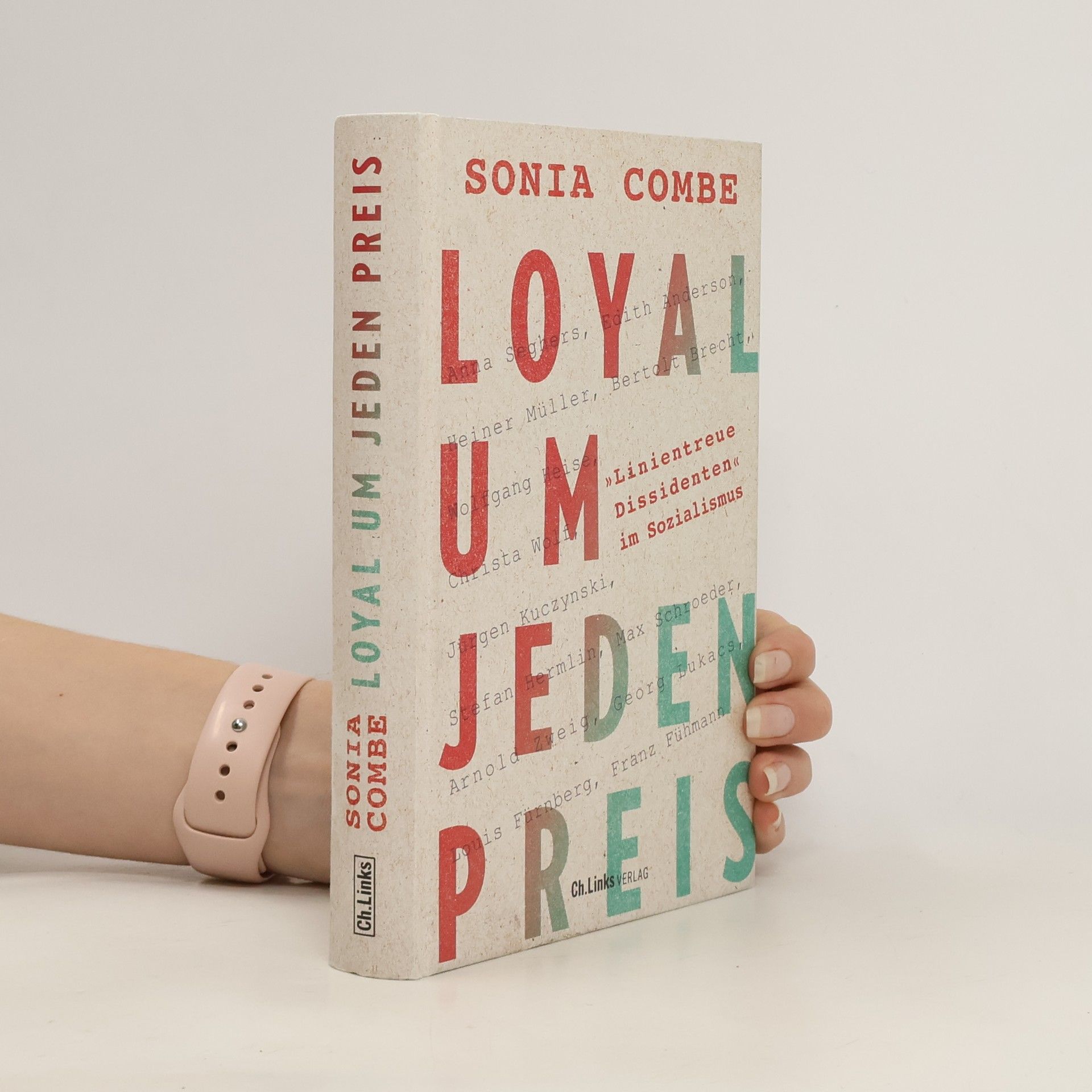Loyal um jeden Preis
"Linientreue Dissidenten" im Sozialismus
DDR-Intellektuelle zwischen Hoffnung und Enttäuschung Anna Seghers, Bertolt Brecht, Stefan Heym, Jürgen Kuczynski, Paul Dessau, Max Schroeder und viele andere wurden wegen ihrer jüdischen Herkunft oder wegen ihrer kommunistischen Überzeugung im »Dritten Reich« verfolgt und mussten Deutschland verlassen. Nach dem Exil in England, den USA oder Mexiko wählten sie die Sowjetische Besatzungszone bzw. die DDR als Heimat. Die Konflikte zwischen den Westremigranten und jenen, die aus Moskau in den Ostteil Deutschlands zurückkehrten, gehören zu den zentralen Problemen der DDR-Geschichte. Diesen Intellektuellen schlugen Misstrauen und Verdächtigungen entgegen. Dennoch stützten sie das System und stellten es zugleich infrage. Einzig innerhalb der Partei trugen sie ihre Kritik vor, in der Öffentlichkeit schwiegen sie. Mit dieser Praxis beeinflussten sie auch die Folgegeneration, als deren Repräsentantin Christa Wolf gelten kann. Sonia Combe zeichnet in ihrem Buch die Kämpfe und Gewissenskonflikte dieser kritischen Marxisten nach und fragt, welchen Preis sie für ihre Loyalität zahlten. »Seit Wolfgang Schivelbuschs ›Vor dem Vorhang‹ und Werner Mittenzweis ›Die Intellektuellen‹ und ›Zwielicht‹ hat Sonia Combe den umfassendsten Beitrag zur Intellektuellengeschichte der DDR geschrieben.« The Times Literary Supplement (TLS)