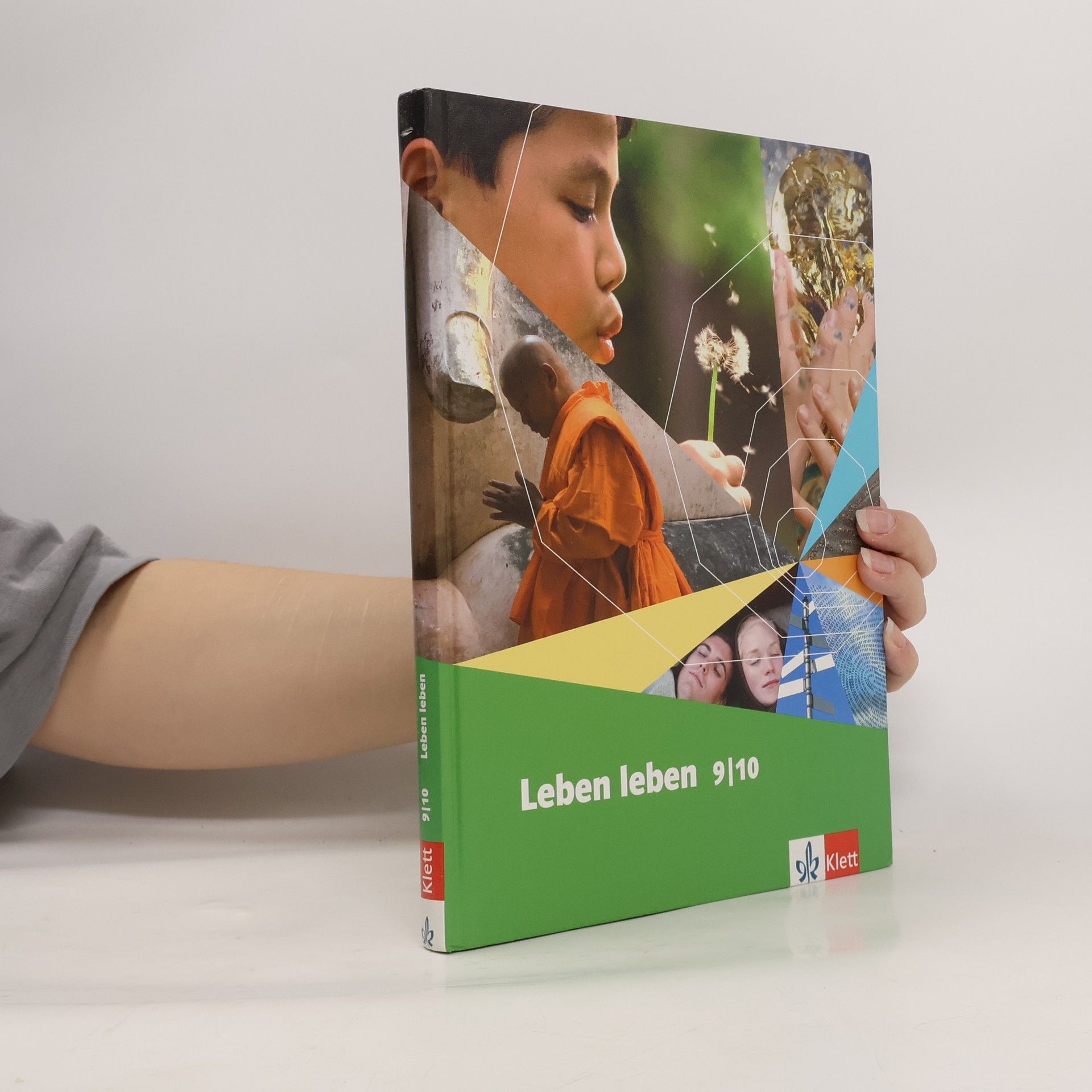Poetischer Sinn
Essay über den Geist der Sprache und die Sinngeltungsfunktion des Todes
- 200pages
- 7 heures de lecture
Im Fokus steht das komplexe Verhältnis zwischen Poesie und Tod, wobei Poesie als Ausdruck von Sinn und Bedeutung betrachtet wird, während der Tod als Symbol der Sinnentleerung gilt. Der Autor untersucht, wie jede Erfüllung von Bedeutung auch die Gefahr der Entleerung birgt und wie Leerformen neue Sinnschöpfungen ermöglichen. Das Werk knüpft an frühere Monographien des Autors an und richtet sich an philosophisch Interessierte, indem es Themen der philosophischen Anthropologie und Sprachphilosophie behandelt.