Der von Irene Albers herausgegebene Band untersucht die Provenienz und die vielfältige Bedeutung des Kanaga-Zeichens, das seit 1977 als Signet des Verlags Matthes & Seitz dient. Er enthält Dokumente zur Geschichte der Dogon-Masken und deren Einfluss auf die afrikanische Identität, sowie Beiträge von Sylvie Kandé und Éric Jolly zur globalen Zirkulation des Zeichens.
Irene Albers-Richter Livres
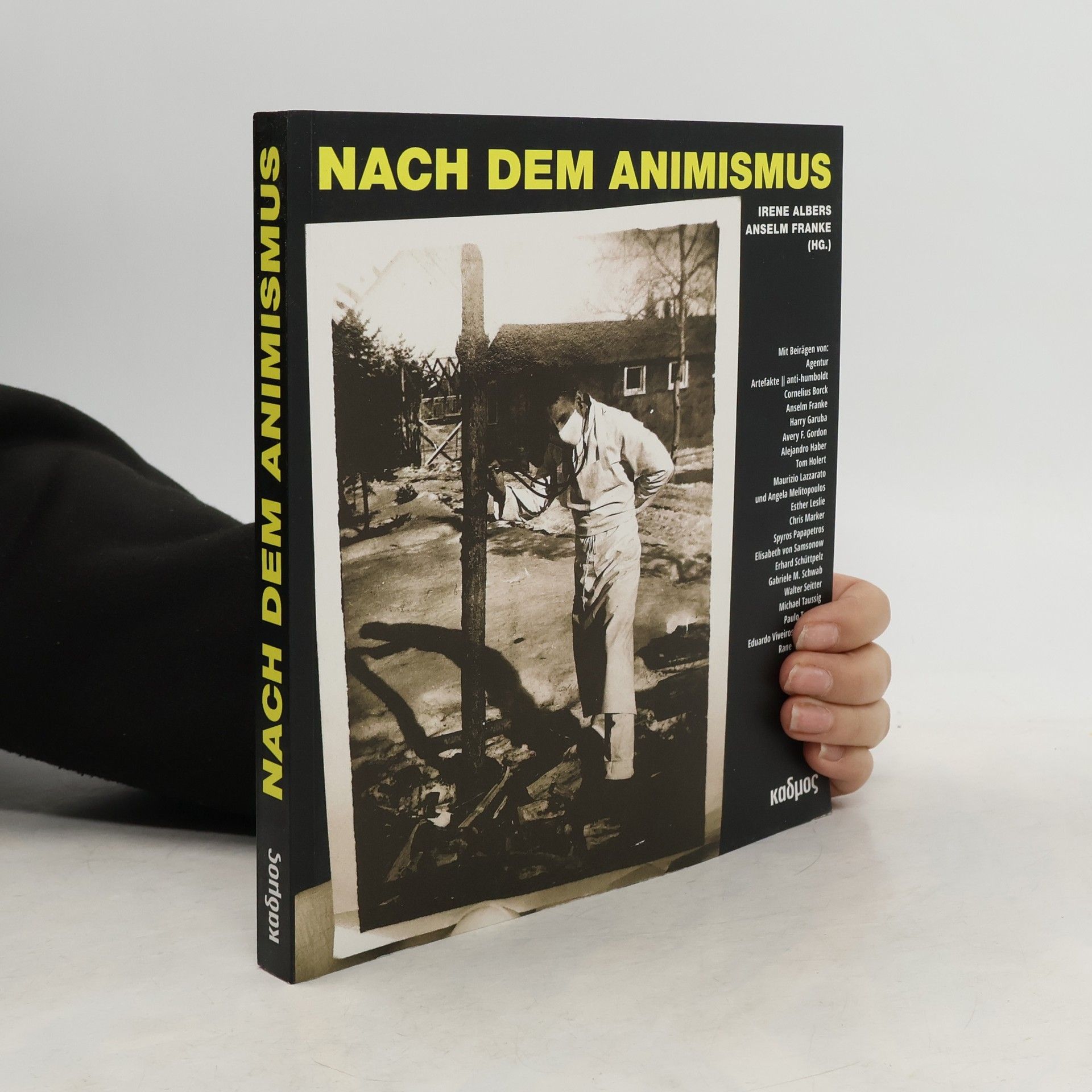


Animismus
- 319pages
- 12 heures de lecture
Der »Animismus« ist eine Erfindung der Ethnologie des 19. Jahrhunderts, geprägt auf dem Höhepunkt des europäischen Kolonialismus. Animisten bevölkern die unbelebte Natur mit Seelen und Geistern. Das erklärt man als eine die materielle Realität verkennende »Projektion«, durch die den Dingen und der Natur Leben und Handlungsmacht zugeschrieben wird. Animismus wird so zum Gegenbild moderner Wissenschaft, zum Ausdruck eines »Naturzustands«, in dem Psyche und Natur als ungeschieden gelten. Wenn sich letzthin ein neues Interesse am Animismus herausgebildet hat, liegt das nicht daran, dass der Begriff als wissenschaftliche Kategorie rehabilitiert wurde. Vielmehr ist die kategorische Trennung von subjektiver und objektiver Welt selbst in Bewegung geraten. Der Band versammelt zentrale Texte dieser Debatte, die hier erstmals einer deutschsprachigen Leserschaft zugänglich gemacht werden.
Nach dem Animismus
- 256pages
- 9 heures de lecture
'Animismus' bezeichnet Praktiken und Ontologien, die die Natur und Objekte nicht objektiv, sondern subjektiv wahrnehmen und behandeln. Edward B. Tylor, der den Begriff prägte, sah Animisten als unfähig an, zwischen belebter und unbelebter Materie zu unterscheiden, was zu kolonialistischen Überlegenheitsvorstellungen führte. Der Begriff bezieht sich nicht auf eine Wiederbelebung, sondern auf eine notwendige Revision, die durch ethnologische Beiträge verdeutlicht wird, darunter ein Text des brasilianischen Ethnologen Eduardo Viveiros de Castro, der eine Welt mit vielfältigen subjektiven Positionen entwirft. Animismus wird als relationale Epistemologie oder Ontologie verstanden, die die Differenz von Natur und Kultur provoziert und nicht-menschlichen Akteuren Handlungsmacht verleiht. Paulo Tavares diskutiert, wie die Natur zum Rechtssubjekt werden kann, während das 'animistische Imaginäre' innerhalb der westlichen Moderne thematisiert wird. Bruno Latour hinterfragt, wie die Moderne Materie für tot erklärt und gleichzeitig den Animismus zum Schweigen bringt. Die Beiträge des Bandes nutzen das Animismus-Konzept als analytisches Werkzeug, um ethnographische Perspektiven auf Wissenschaft, Wirtschaft, Kunst und Philosophie zu reflektieren. Der Band versammelt wissenschaftliche und künstlerische Beiträge aus der Konferenz und Ausstellung 'Animismus' im Haus der Kulturen der Welt.