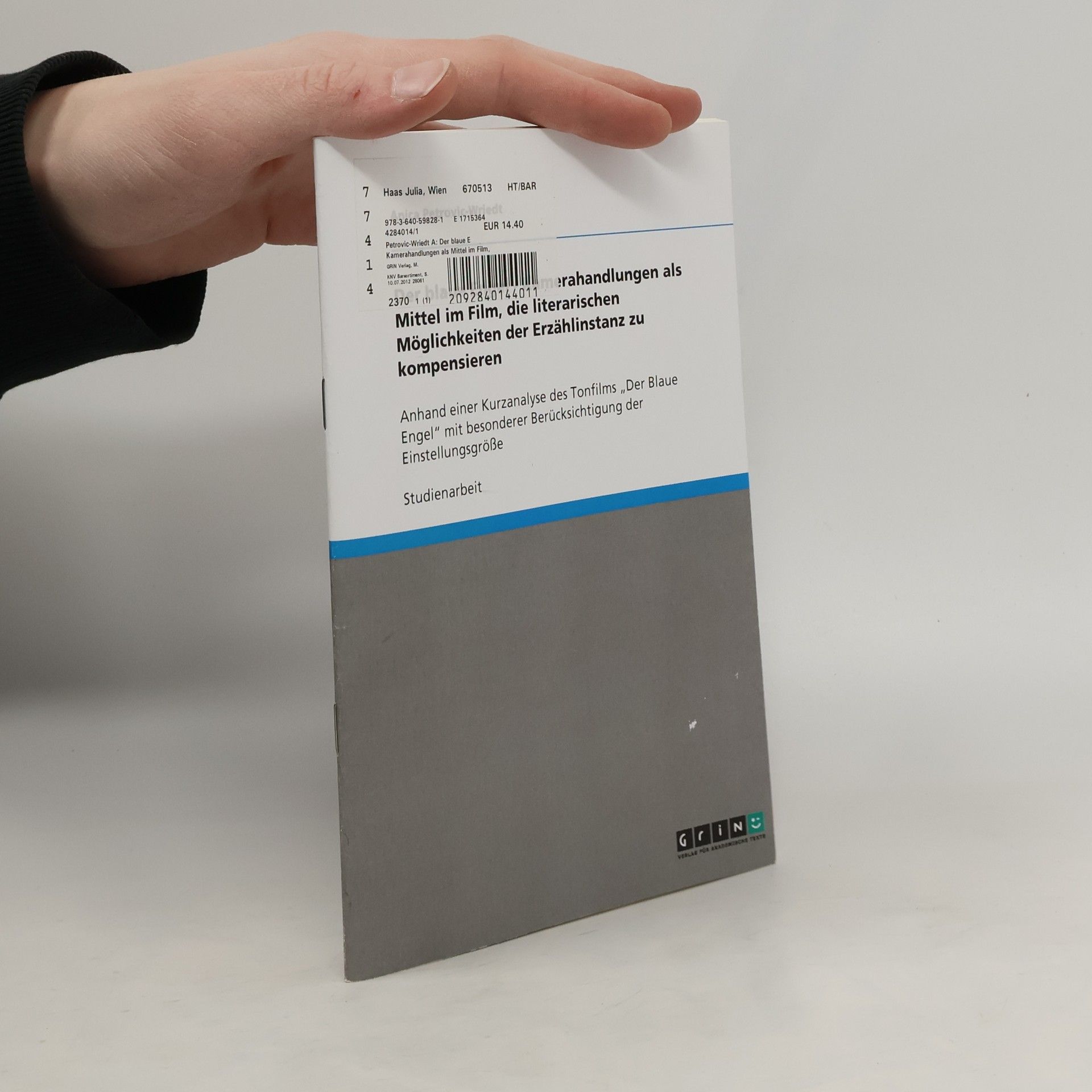Der blaue Engel - Kamerahandlungen als Mittel im Film, die literarischen Möglichkeiten der Erzählinstanz zu kompensieren
Anhand einer Kurzanalyse des Tonfilms Der Blaue Engel mit besonderer Berücksichtigung der Einstellungsgröße
Studienarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich Didaktik - Germanistik, Note: unbenotet, Universität Potsdam (Germanistik), Veranstaltung: Seminar, Sprache: Deutsch, Abstract: In dem Teil der Literaturwissenschaft, der sich mit der Interpretation literarischer Texte auseinandersetzt, wird immer auch die Erzählinstanz des Textes berücksichtigt. Diese gilt in der Regel als zentrale Instanz bei der Interpretation und bestimmt auch zum Teil die Rezeption eines Werkes. In der Filmwissenschaft besteht noch kein Konsens darüber, ob filmische Erzählungen durch eine Erzählinstanz vermittelt werden.