Der Band beschreibt in einer thesenstarken Grundsatzbetrachtung und in einer Reihe von erläuternden Essays, die mit Belegen und Fallbeispielen arbeiten, den Status des frühneuzeitlichen deutschen Reiches als Referenzsystem für die Föderalismusdebatten in den entstehenden USA. Jürgen Overhoff, Volker Depkat und Johannes Burkhardt analysieren Entwicklungsprozesse im britisch-kolonialen und revolutionären Amerika in ihren imperialen und transatlantischen Kontexten von den Anfängen im 17. Jahrhundert über die Unabhängigkeitserklärung bis zur Ratifizierung der Verfassung der USA im Jahr 1788. Auf diese Weise wird deutlich, dass die revolutionär gegründeten USA nicht ohne Rekurs auf europäische Verfassungsordnungen auskamen. Im Rahmen eines transatlantischen Verfassungsdiskurses, an dem William Penn, Baron de Montesquieu, Benjamin Franklin, Johann Stephan Pütter, John Adams, Thomas Jefferson und James Madison teilnahmen, diente die Organisation des als „confederate republic“ begriffenen deutschen Reiches der Klärung eigener Standpunkte.
Johannes Burkhardt Ordre des livres



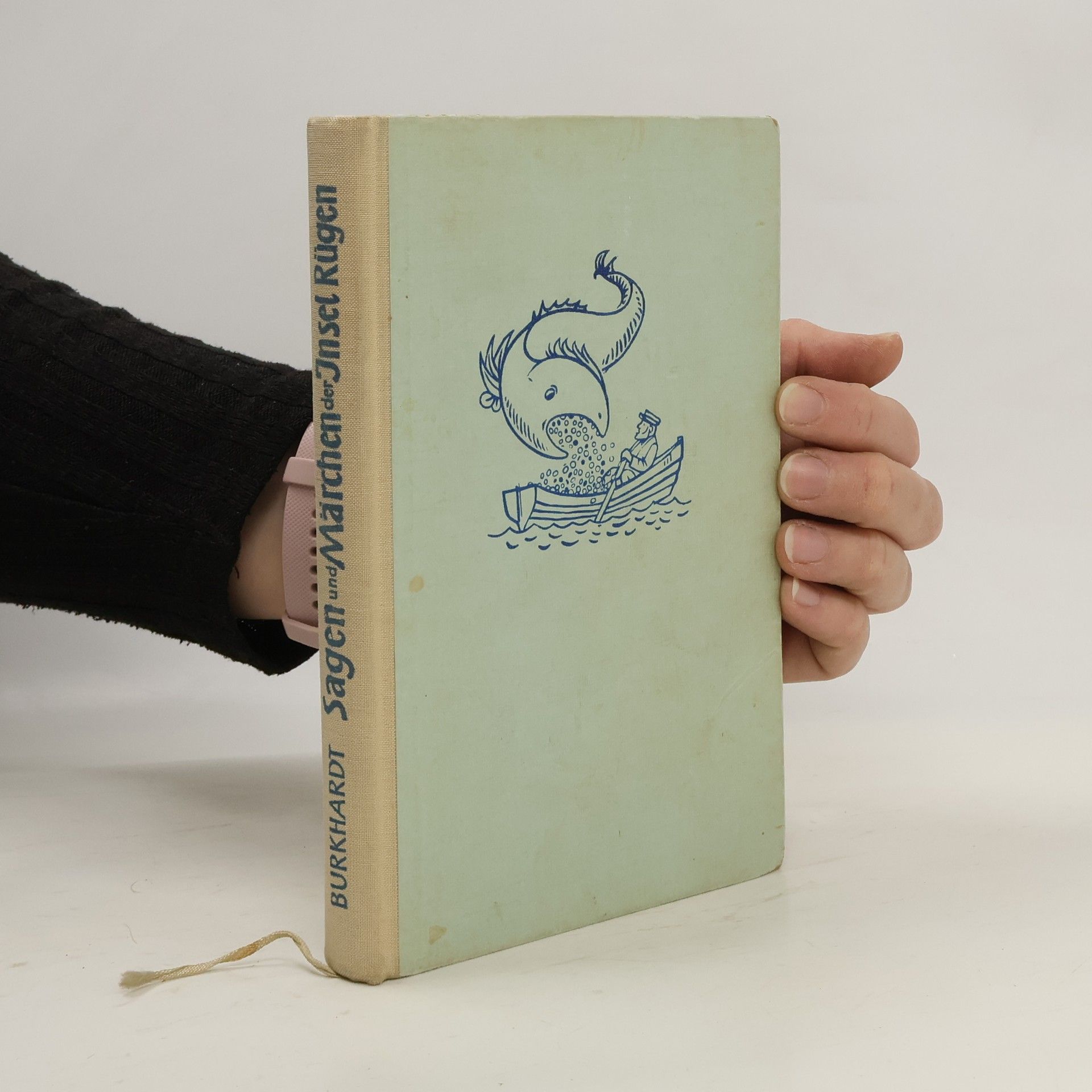
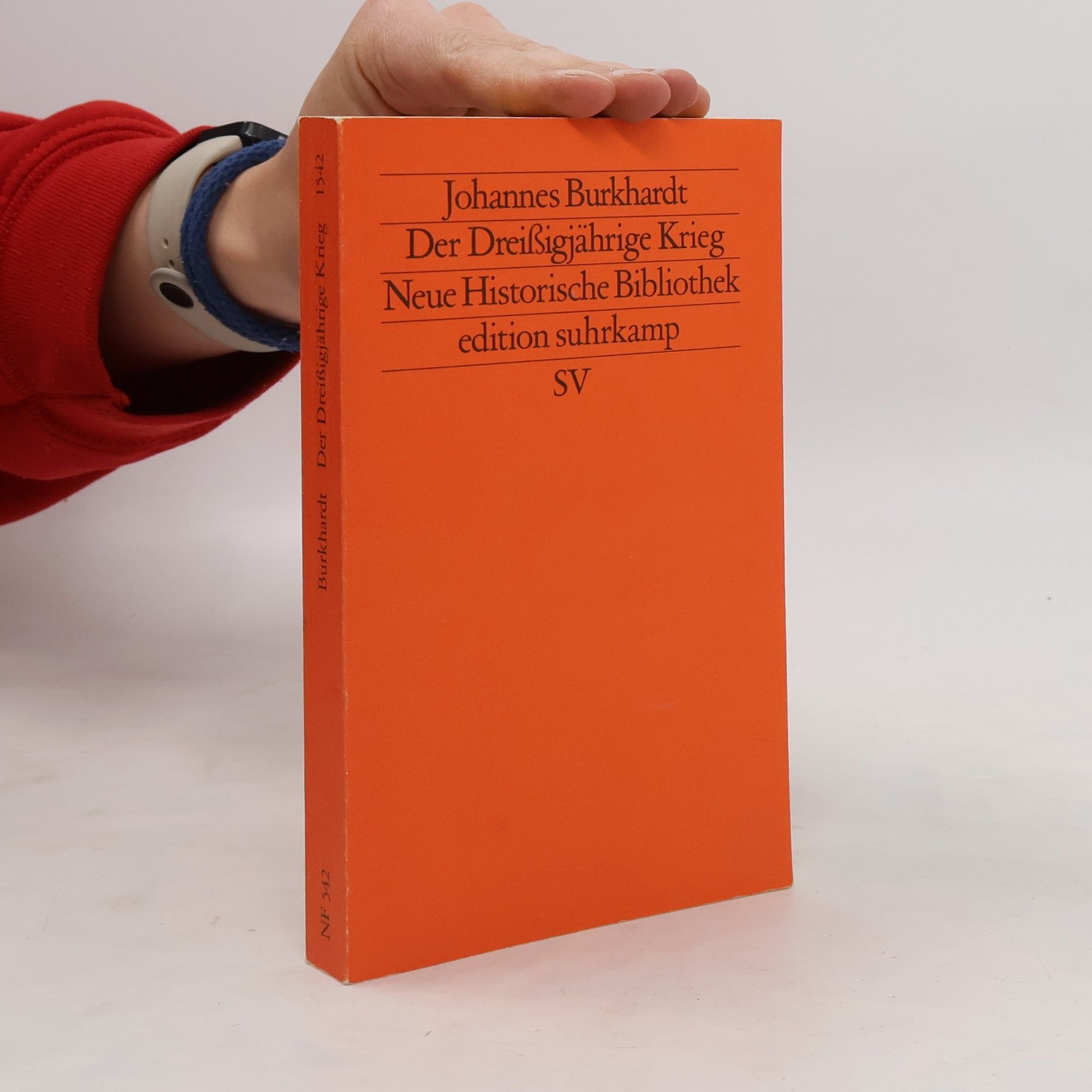
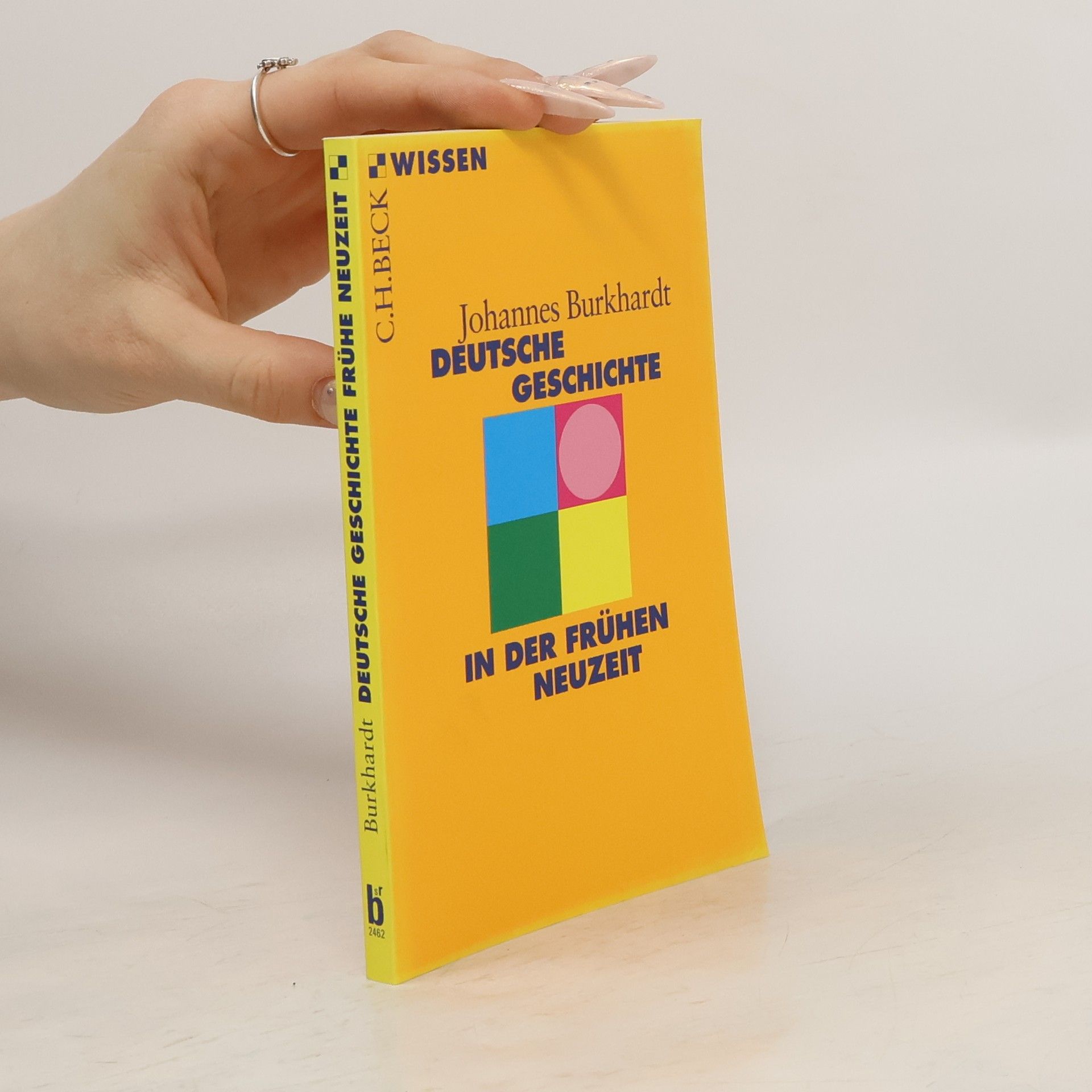
- 2023
- 2014
Zwölf Fuggervorträge
Mit einer Auswahl von Buchpräsentationen
Der Band umfasst zwölf Vorträge über Fugger, die Johannes Burkhardt als Wissenschaftlicher Leiter des Fugger-Archivs über zwei Jahrzehnte hinweg gehalten hat. Das besondere Interesse Burkhardts galt immer der historischen Erinnerungskultur als ihr Erforscher wie auch selbst als Redner bei Jubiläen und zu besonderen Ereignissen, an denen die Fuggermemoria reich ist. Der Band sammelt bereits gedruckte Vorträge, bietet aber auch zur guten Hälfte Erstdrucke und löst damit den vielfach geäußerten Wunsch ein, die geschliffen ausgearbeitete wie spontane Rede nachlesbar zu machen. Die Beiträge lassen die Entwicklung Burkhardtscher Leitmotive nachvollziehen, die er in die Fuggerforschung eingebracht hat. Als ein 'Lob der Fuggerforschung' – ernst und heiter – sind Präsentationen herausragender Fuggerarbeiten im zweiten Teil des Vortragsbandes wiedergegeben.
- 2009
Deutsche Geschichte in der frühen Neuzeit
- 135pages
- 5 heures de lecture
Johannes Burkhardt bietet einen ebenso informativen wie kompakten Überblick über die Richtungsweisenden Errungenschaften der Frühen Neuzeit in Deutschland, deren Nachwirkungen bis zum heutigen Tag spürbar sind. Er analysiert unter anderem die föderale Struktur des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, untersucht den durch die Konfessionalisierung bewirkten gesellschaftlichen Wandel, erläutert die Ursachen des Dreißigjährigen Krieges und schildert die Bedeutung grundlegender wissenschaftlicher und kultureller Entdeckungen wie die Erfindung des Buchdruckes.
- 2006
Band 11 behandelt die Epoche nach dem Westfälischen Frieden und beleuchtet die revisionsbedürftigste Phase der deutschen Geschichte. Anstelle von Zersplitterung erkennt die Forschung wegweisende Organisationsperspektiven wie föderale, partizipatorische, rechtsstaatliche und friedenssichernde Ansätze. Die Gesamterzählung analysiert die institutionelle Vollendung des frühmodernen Reiches angesichts europäischer Kriege und bilanziert die Errungenschaften des politischen Systems, darunter die nachwirkende Kultur und das mediengesättigte 'Reich der Schriftlichkeit'. Im Mittelpunkt steht die „Große Politik“, die nun als Reichspolitik neu bewertet wird, insbesondere auf der gesamtstaatlichen Steuerungsebene des aufsteigenden Amtskaisertums, der Reichsinstitutionen und des verstetigten Reichstags. Besonders hervorzuheben ist die Friedenswahrung nach innen, die defensive Sicherheitspolitik in Zeiten europäischer Kriege sowie der Ausbau der Verfassungs- und Rechtskultur. Der Band bietet eine analytische Erzählung von der institutionellen Vollendung des Reiches bis zu seiner notwendigen Neuorientierung im 18. Jahrhundert, bilanziert die Leistungen dieses politischen Systems für die deutsche Geschichte und schließt die Epoche der Frühen Neuzeit (Bände 9 bis 12) ab.
- 2002
Das Reformationsjahrhundert
Deutsche Geschichte zwischen Medienrevolution und Institutionenbildung 1517-1617
- 244pages
- 9 heures de lecture
Das Reformationsjahrhundert war eine der großen Zeiten deutscher Geschichte mit nachhaltigen Wirkungen. Die vorliegende Bilanz stellt erstmals die gesamte Reformationsgeschichte von ihrer für uns auch aus der Druckerpresse. Ebenso wichtig war die Institutionenbildung in Religion und Politik, zu der neue Forschungsergebnisse vorliegen, die das ganze Geschichtsbild verändern. Von der moderneren Konfessionalisierungsforschung ausgehend bestimmt das Buch Typen und multikulturelle Auswirkungen der Konfessionsbildung. „Staatsbildung - aber wie?“ war die andere Frage der beginnenden Neuzeit. Die glanzvolle Europapolitik Karls V. und der Aufbau der deutschen Doppelstaatlichkeit gaben Antworten mit institutioneller Zukunft. Das frühmoderne Reich war - gemessen am Entwicklungsstand von Information und Institution - nicht zurückgeblieben, sondern Europas fortgeschrittenster Staat.
- 1992
Über den Dreißigjährigen Krieg ist viel geschrieben worden. Und doch sind noch viele Fragen offen. Ein »Krieg der Kriege«, im Sinne einer Akkumulation von Kriegen und Konflikttypen, steht im Mittelpunkt des Interesses. Als kriegstreibende Faktoren werden mentale, konfessionelle, ökonomische, militärtechnische, soziale und genuin politische Strukturen gewichtet. Kriegsverlängernd wirkten nicht zuletzt die Etablierungsprobleme des modernen Staatensystems, das sich zwischen Universalkonzeptionen und Ständerecht im Laufe dieses Krieges erst durchsetzte. Die Verstaatlichung von Krieg und Frieden steckte noch in einer Übergangskrise und zeigte doch schon die kommenden Schwachstellen. Erste Lösungshorizonte zeichneten sich 1648 in völkerrechtlichen Verhaltensnormen und in der föderativen Verfassung des Reiches deutscher Nation ab. Ein Krieg der Kriege aber war es auch im Sinne einer zum Mythos gebündelten außergewöhnlichen Kriegserfahrung. Die Steigerung des Kriegsschreckens gründet vor allem in der zum Dauerzustand gewordenen Bedrohung – den Alltagslasten, Überlebensleistungen und Bewältigungsformen eines Krieges, der nicht enden wollte.
