Bruno W. Reimann Livres
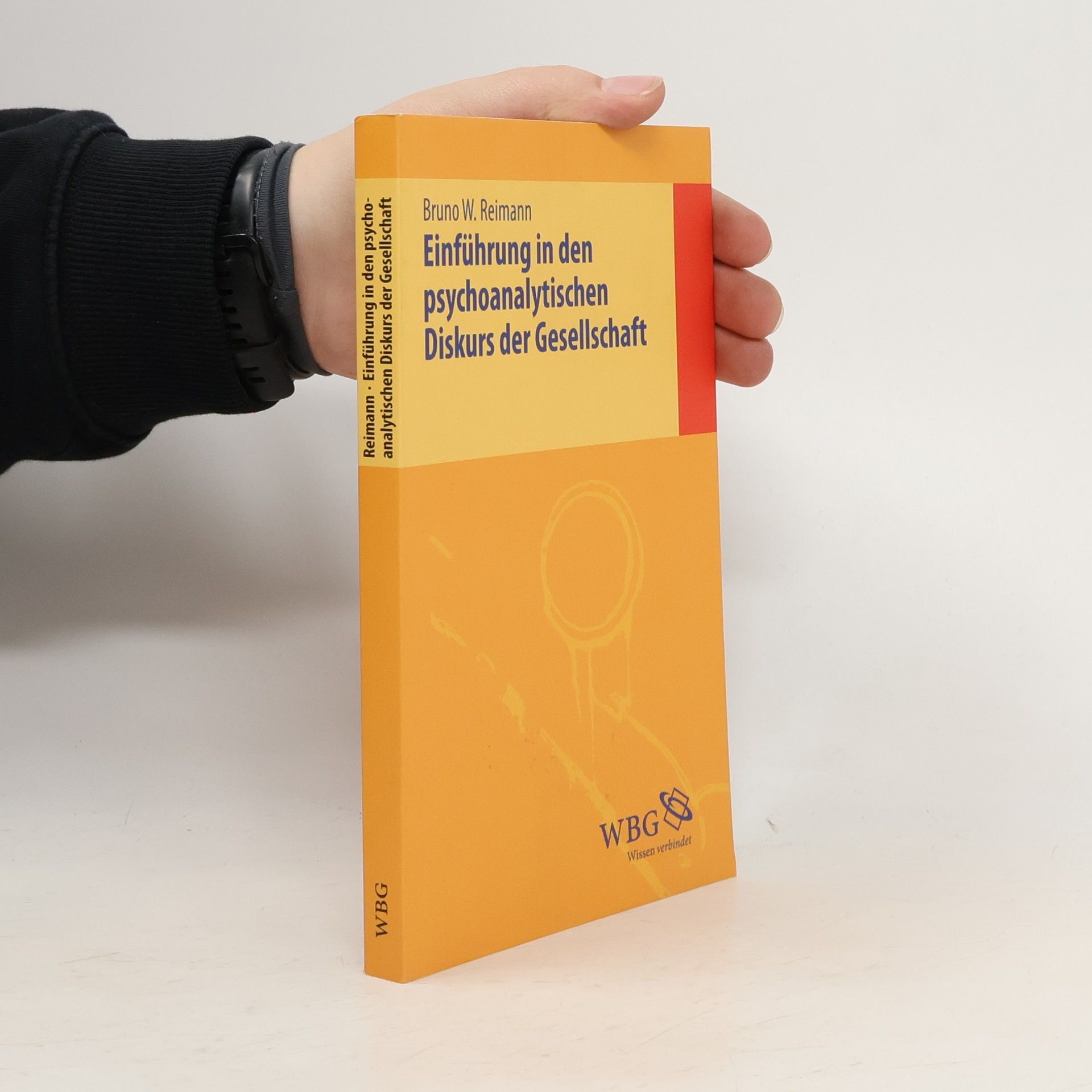
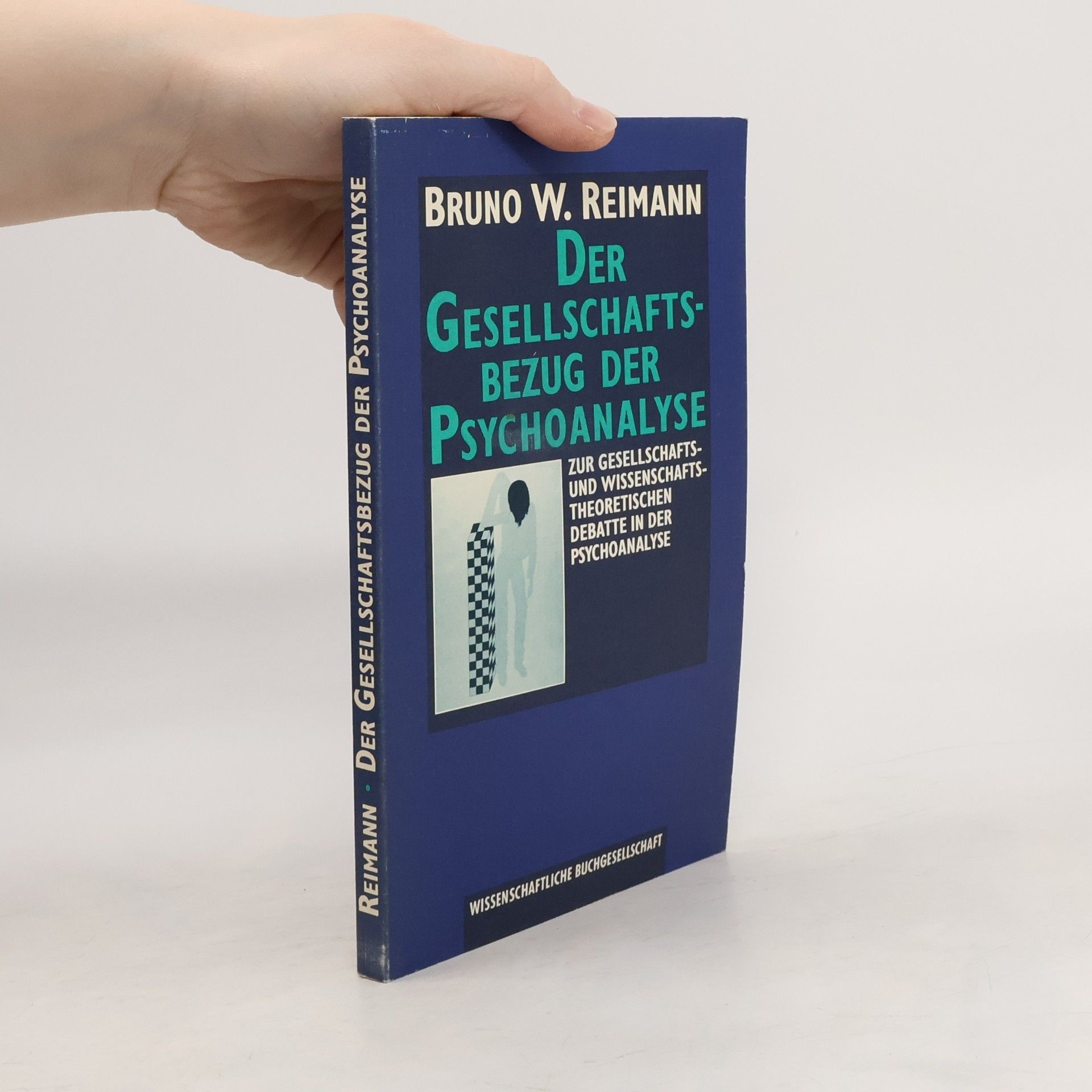
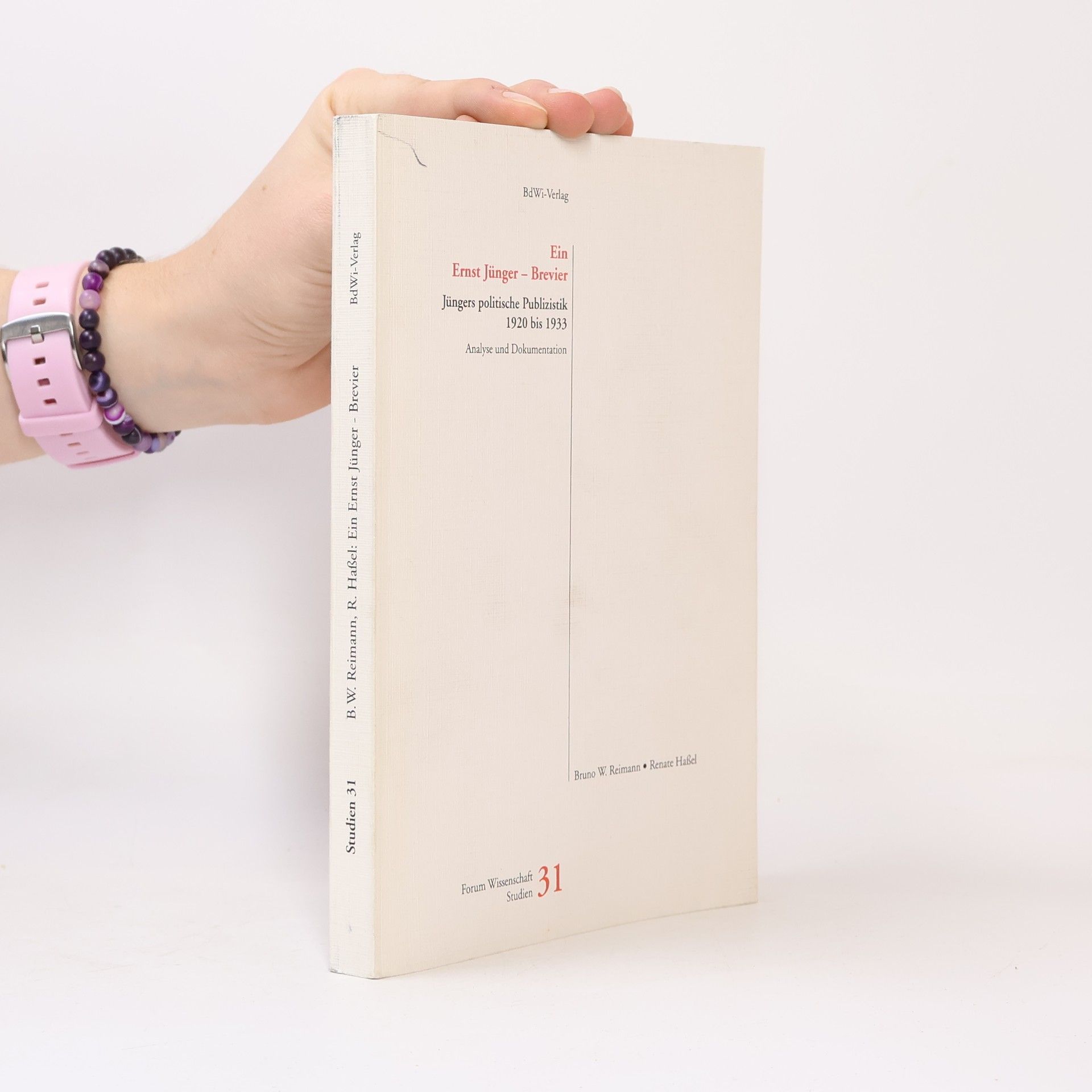
Ausgangspunkt des vorliegenden Buches ist der revolutionäre Geist der Arbeiten Sigmund Freuds. In den zentralen kulturtheoretischen Fragen erreichten diese eine außergewöhnliche Radikalität. Die Psychoanalyse-Debatten der 1960er und 1970er Jahre nahmen vorschnell Theoriehürden, überreizten ihre Mittel und gerieten bald an ihre Grenzen. Gleichzeitig hat sich die Psychoanalyse in eine ›Therapie-Gesellschaft‹ eingefügt und wurde eine Therapieform unter vielen. Als Theorie aber bleibt sie eine Herausforderung und so ist der psychoanalytische Diskurs, der das Verhältnis von Gesellschaft und Individuum thematisiert, immer noch aktuell! Bruno W. Reimann beschreibt den psychoanalytisch-kulturtheoretischen Diskurs von den Anfängen bis in die jüngste Zeit, wobei die vorliegende Neuausgabe um eine Darstellung der aktuellsten Entwicklungen erweitert wurde. Das Buch ist ein unverzichtbarer Begleiter für Studierende und alle, die sich mit dem Sinn- und Theoriegehalt der Psychoanalyse auseinandersetzen.