Friedrich E. Schnapp Livres


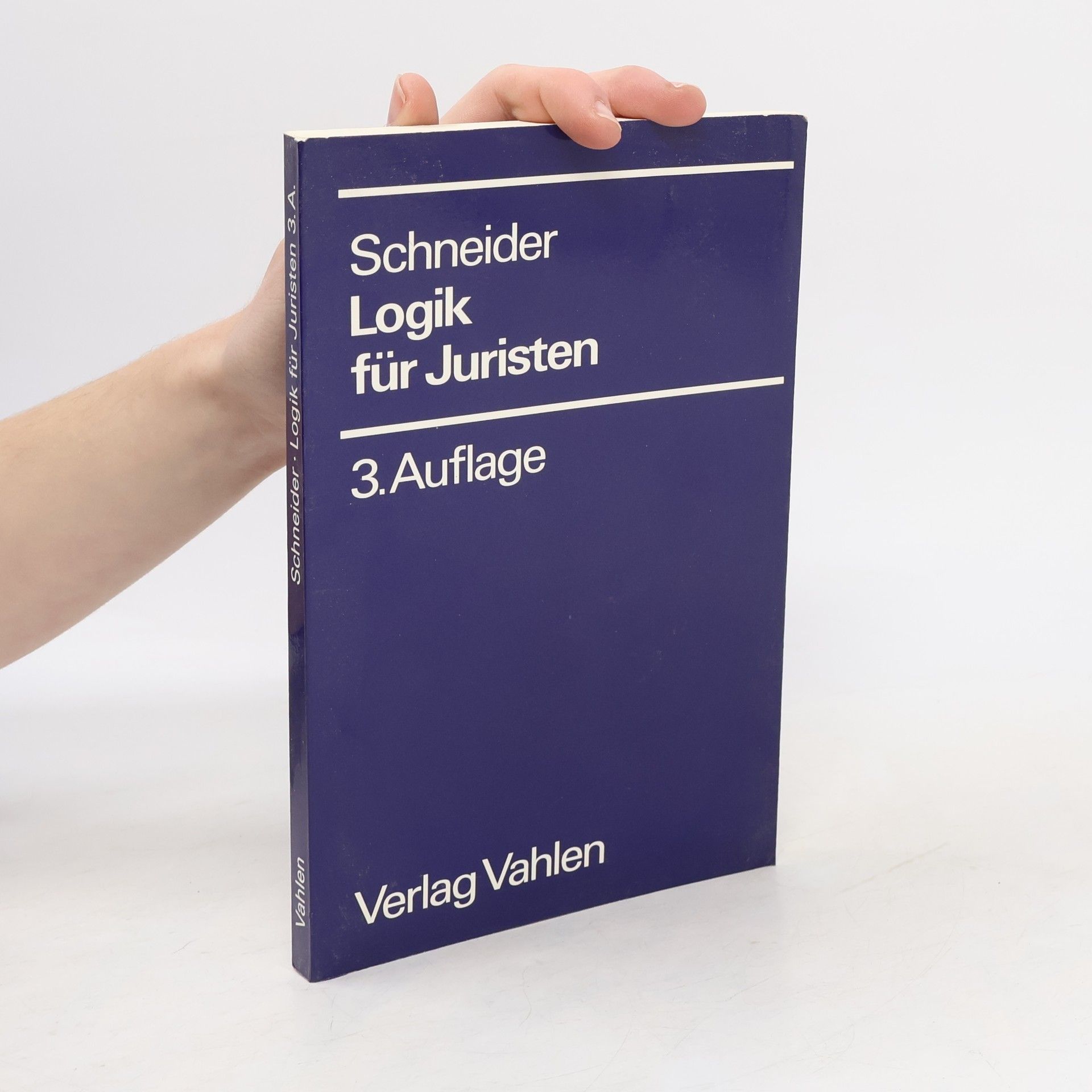
Latein für Juristen
- 140pages
- 5 heures de lecture
Zum Werk Das Lateinische hat wie keine andere Sprache die europäische Kultur und insbesondere die Wissenschaften geprägt. So begegnen einem im Jurastudium zahlreiche lateinische Fachausdrücke, Formeln und Rechtsregeln, die dem römischen Recht entstammen. Dieses Werk zeigt auf, wie das römische Recht in einzelnen Vorschriften und Rechtsgedanken des deutschen Rechts (v. a. BGB, HGB), aber auch in anderen europäischen Rechtsordnungen, seinen Niederschlag gefunden hat und fortlebt. Nach einer knappen Einführung in die Geschichte Roms, seine Institutionen und die lateinische Sprache allgemein (lat. Erbe) werden die wichtigsten lateinischen Rechtsregeln und Rechtssprichwörter - thematisch gegliedert - sprachlich und grammatikalisch erläutert sowie die ihnen zugrunde liegende Denkweise erklärt. Ein Glossar mit den wichtigsten lateinischen Ausdrücken und Redewendungen aus dem Gebiet des Rechts, die in alphabetischer Reihenfolge und mit deutscher Übersetzung aufgelistet sind, kann als Nachschlagewerk im Kleinformat von großem Nutzen sein. Ein Anhang mit Kurzbiographien bekannter römischer Juristen, Rechtsdenker und Schriftsteller sowie lateinischen Namen und Zahlen rundet das Werk ab. Vorteile auf einen Blickanschaulich und unterhaltsam geschriebenverschafft Sicherheit im Umgang mit lateinischen Fachausdrückenschult das logische und präzise Denken Zielgruppe Für Studierende der Rechtswissenschaften, Juristen und Interessierte.